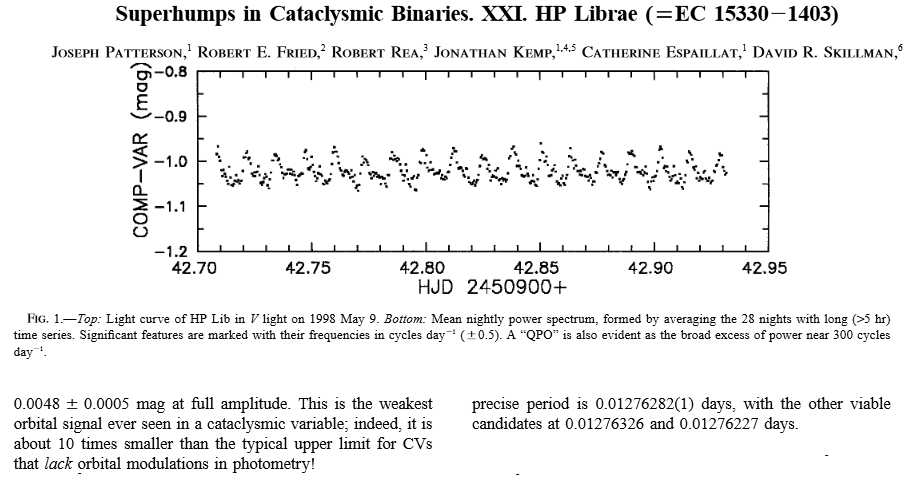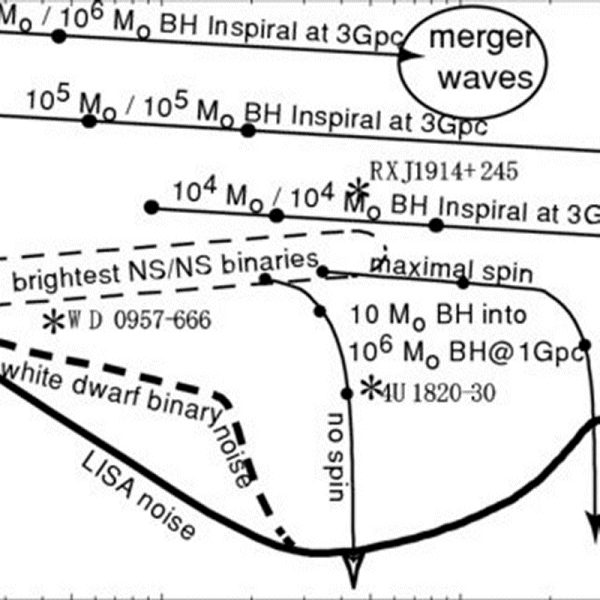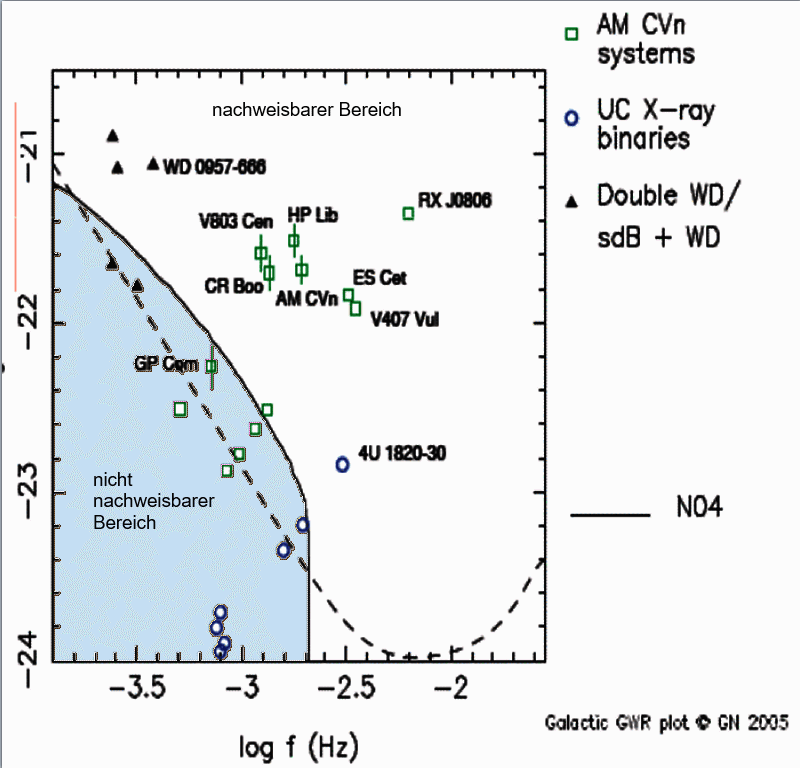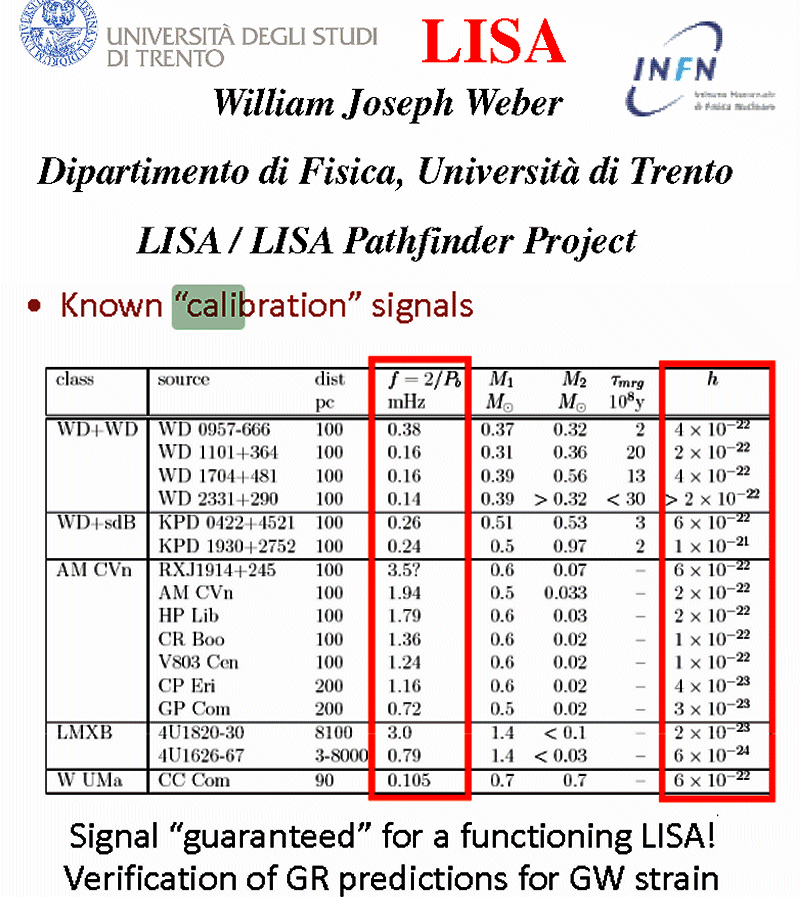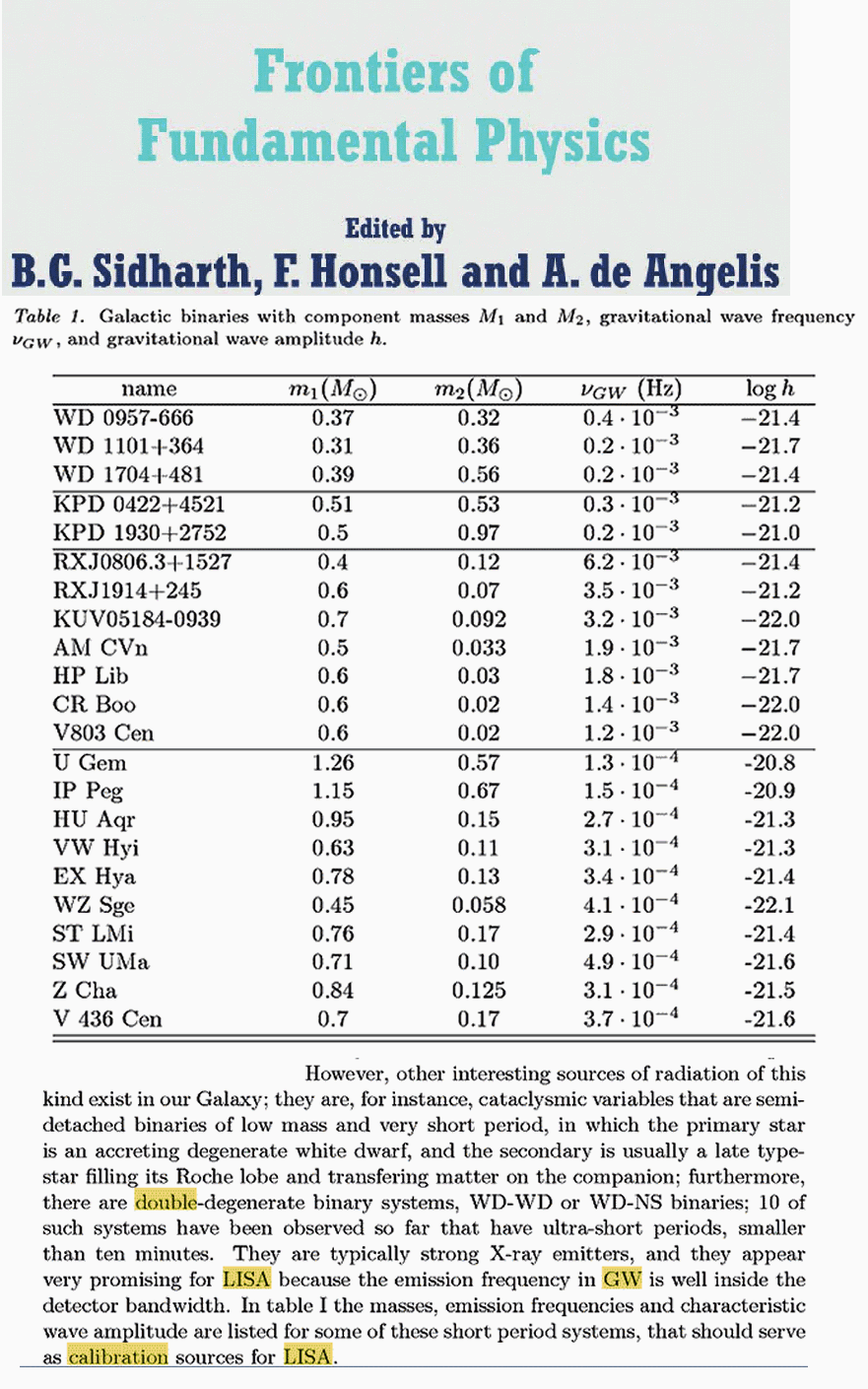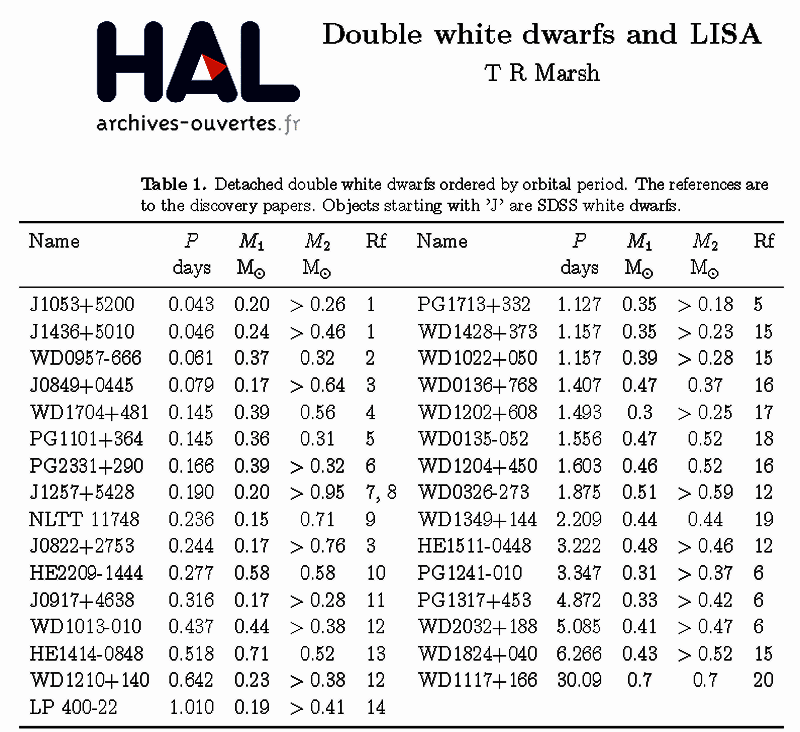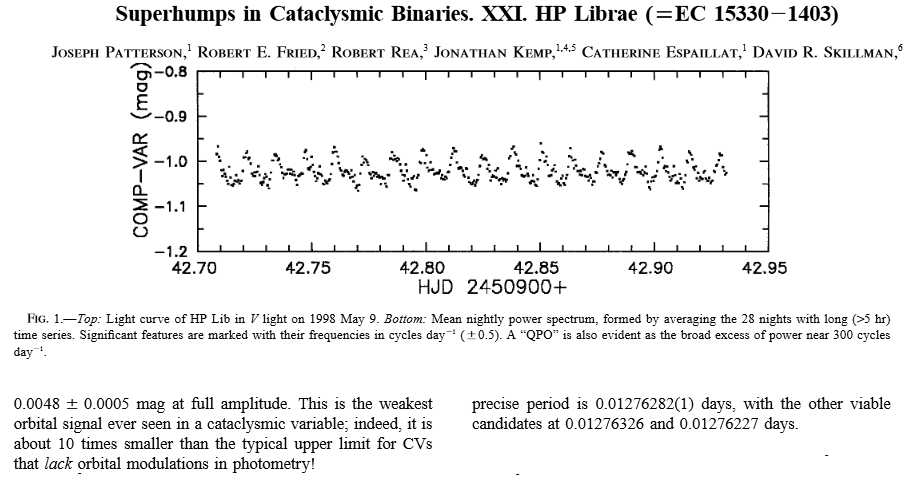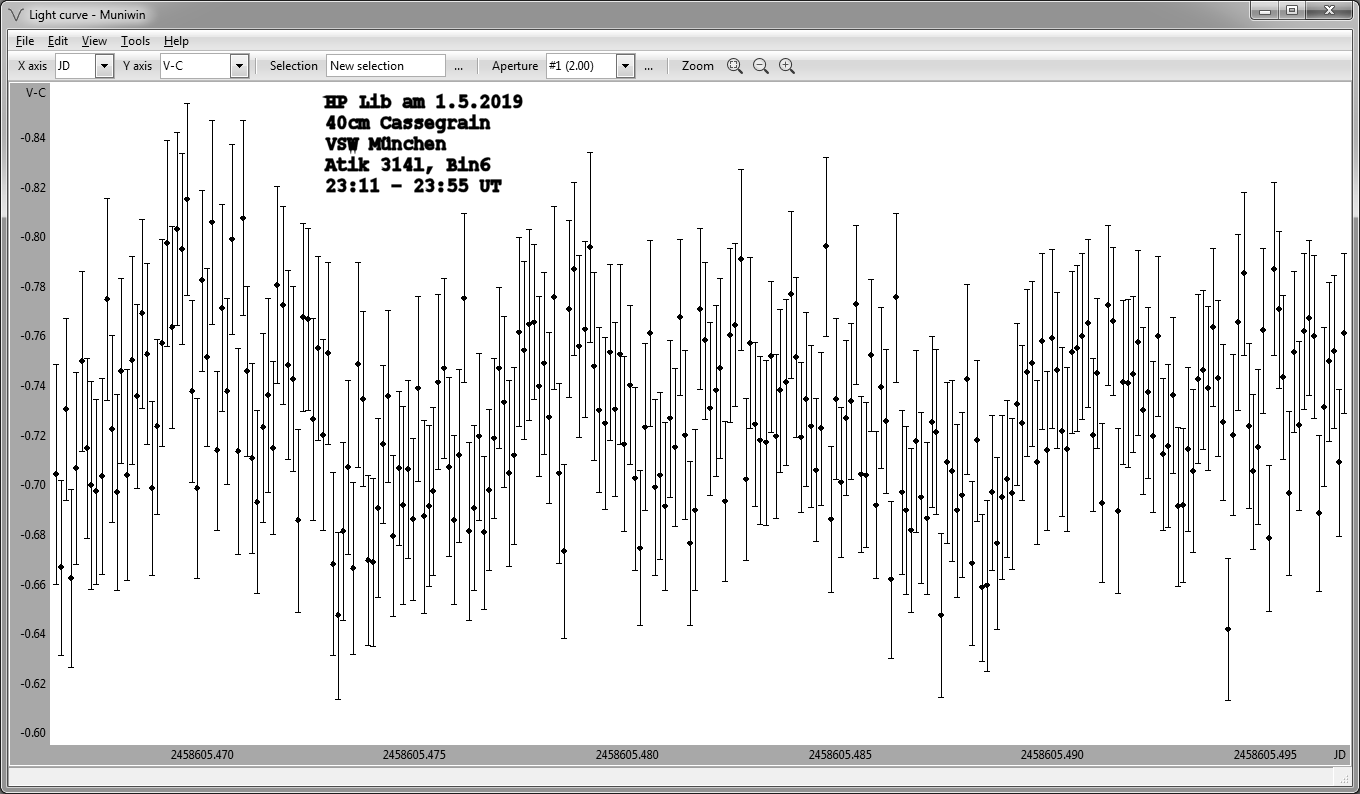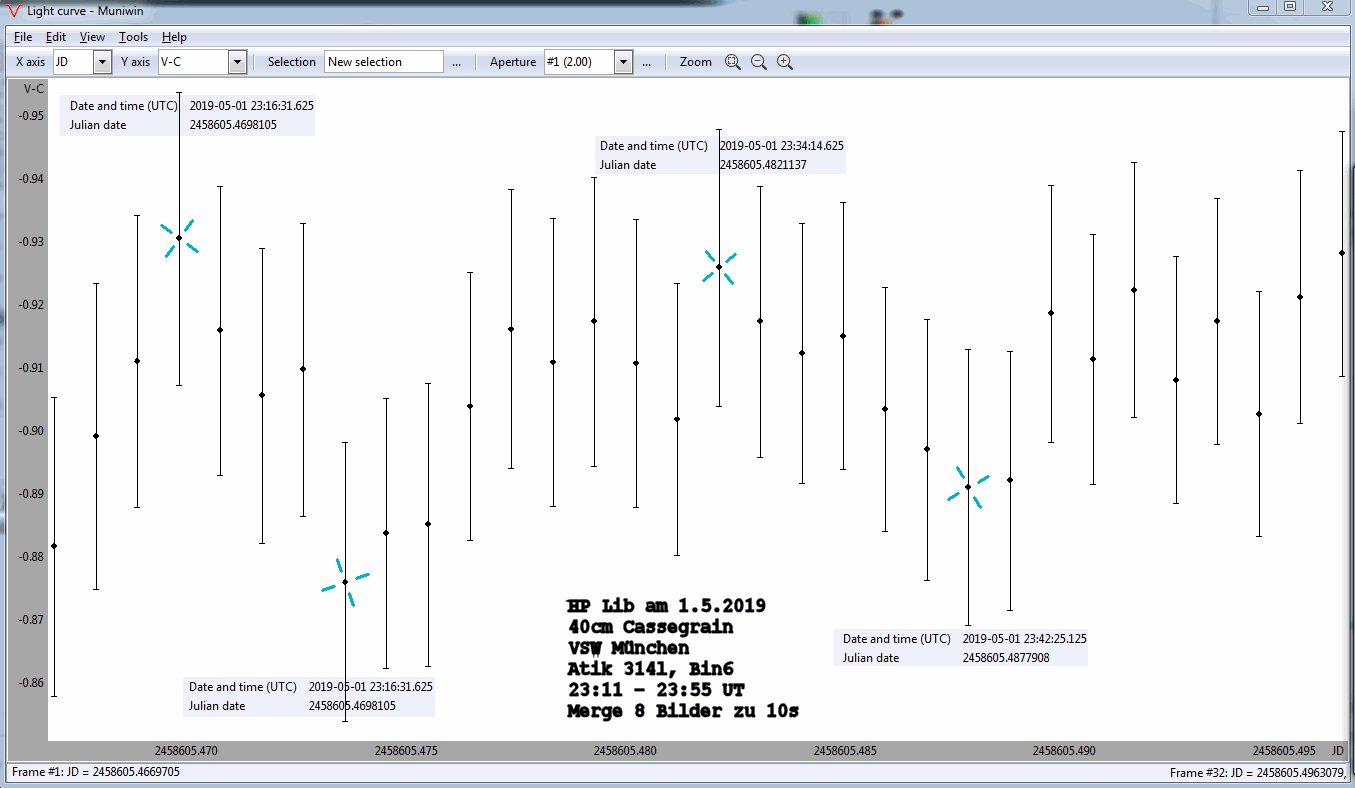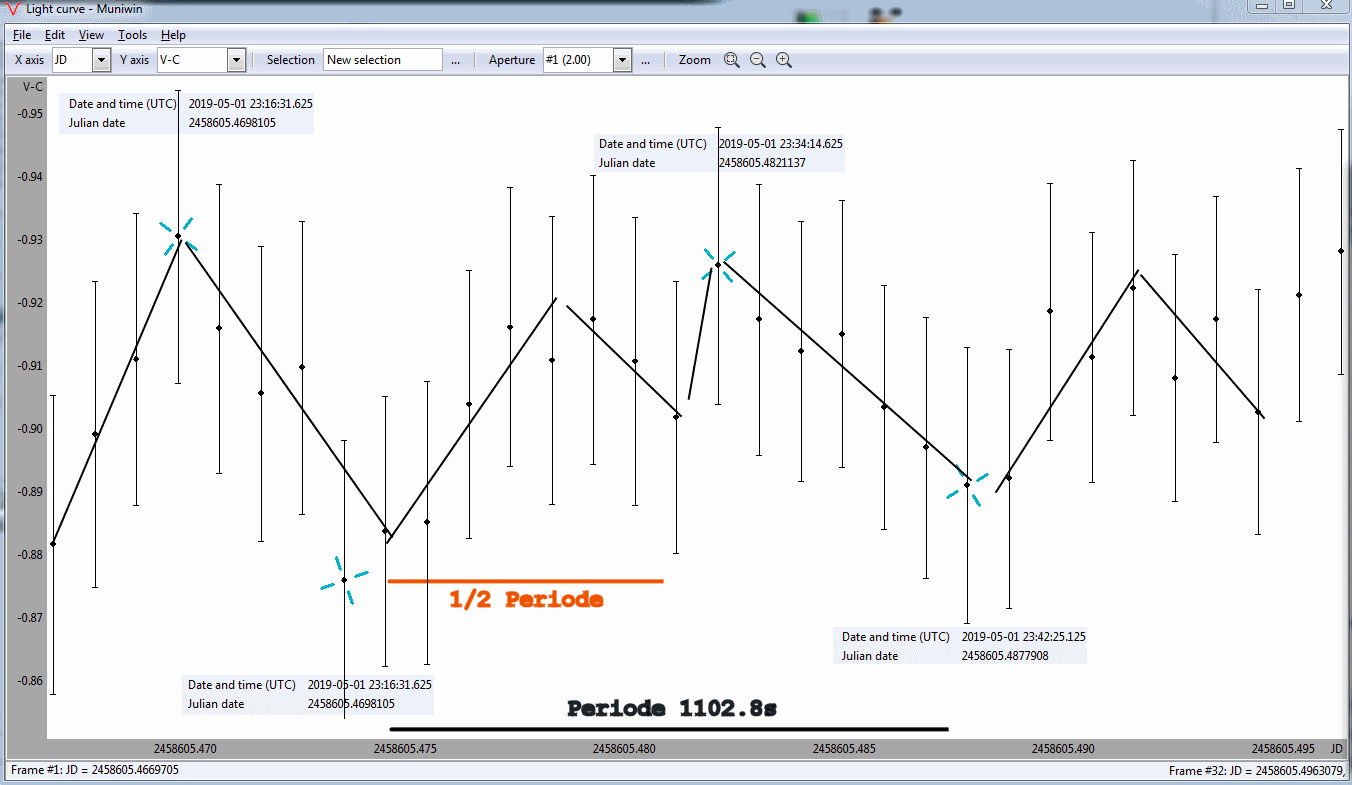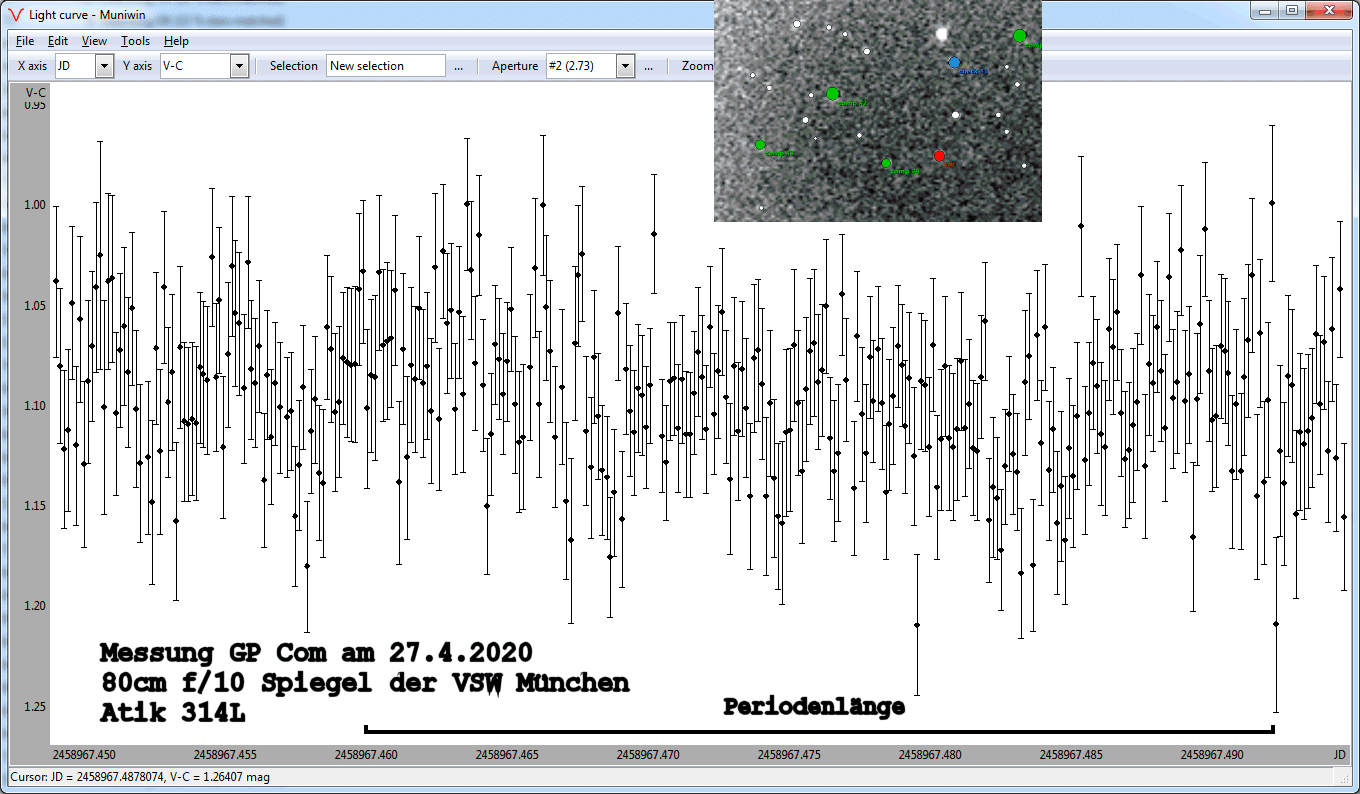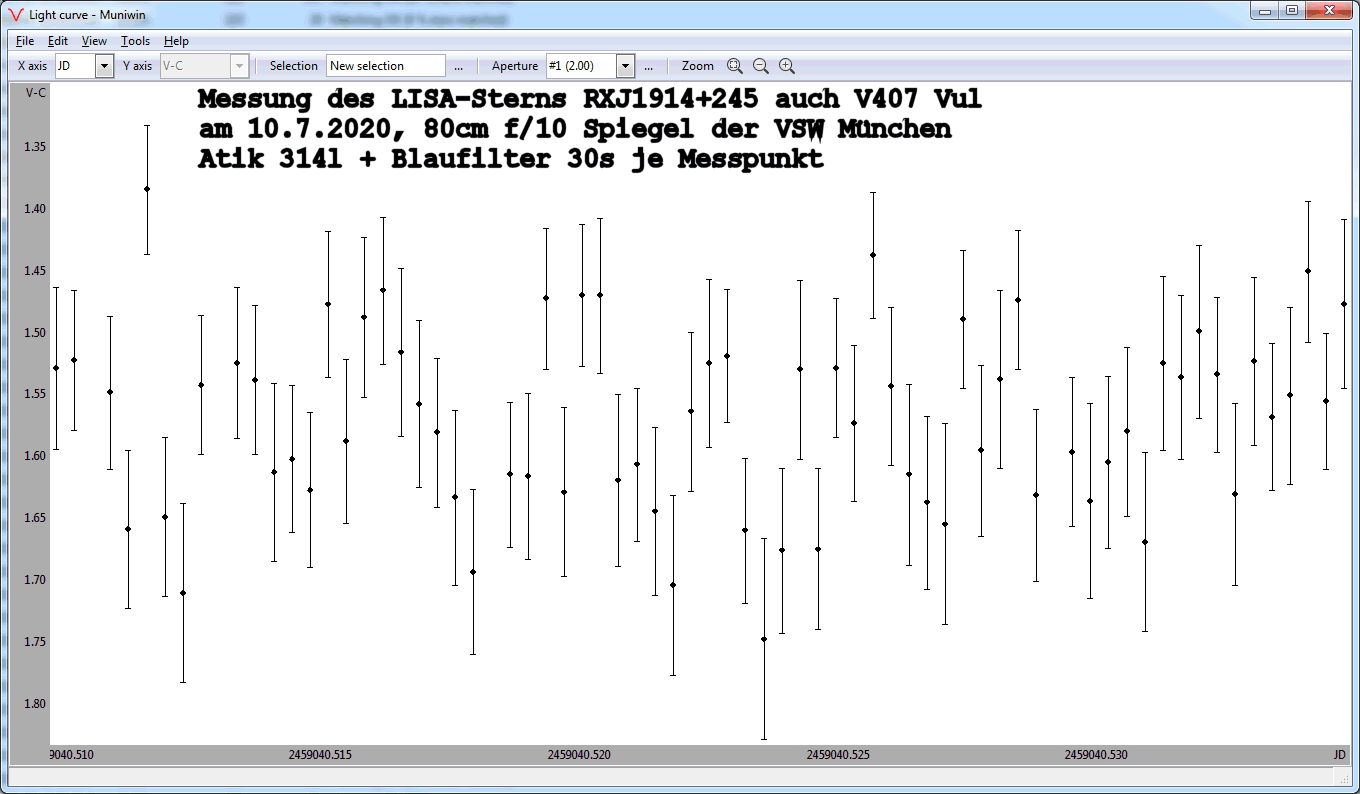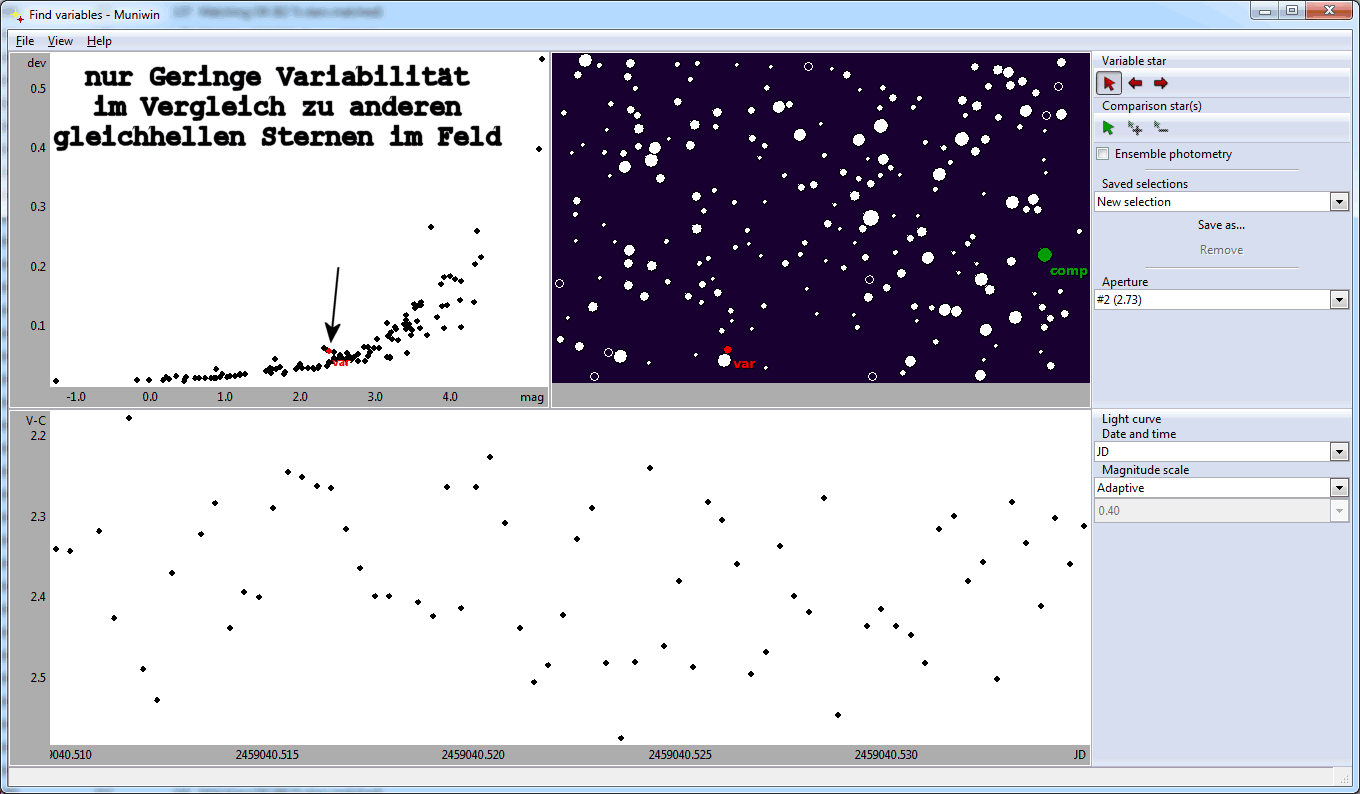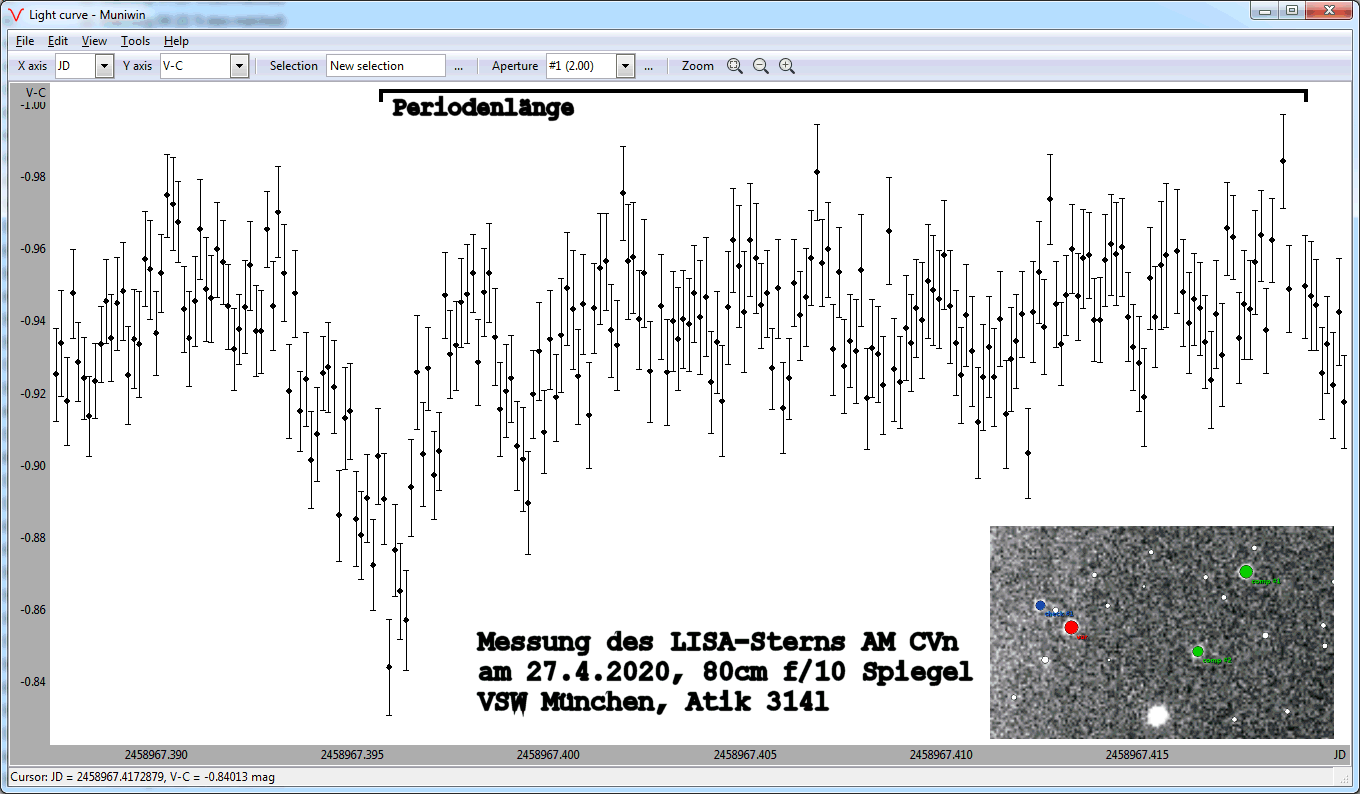LISA-Sterne
HP Lib

Eines der spannendsten Raumfahrtprojekte der nächsten Jahre
ist
der Gravitationswellen-Detektor LISA.
Im Vorfeld haben sich die Wissenschaftler überlegt, welche
Objekte sich damit wohl nachweisen lassen.
Mit den irdischen Detektoren gelang ein Nachweis bisher nur, wenn
riesige Massen in kürzester Zeit beschleunigt wurden.
Speziell beim verschmelzen Schwarzer Löcher. Mit LISA sollen
auch enge Doppelsterne in unserer eigenen Galaxis erreichbar sein.
Die Entfernung ist dabei auch ein wichtiger Faktor. So ist z.B. der
Hulse–Taylor-Pulsar zu weit weg und liegt
vermutlich unter der Nachweisgrenze. Erwartet wird der Nachweis von
hunderten doppelter Weißer Zwerge und
Kataklysmischer Veränderlicher im Umkreis von etwa 1000
Lichtjahren. Die meisten stehen vermutlich hinter galaktischen Staub
und werden visuell nicht sichtbar sein.
- Eine visuelle Sichtbarkeit wäre aber wichtig, um die
Gravitationswellenmessung mit einer visuellen Messung abgleichen zu
können.
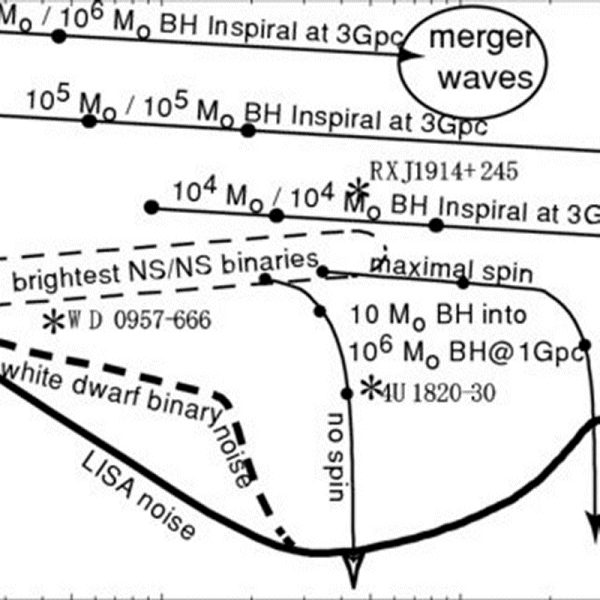
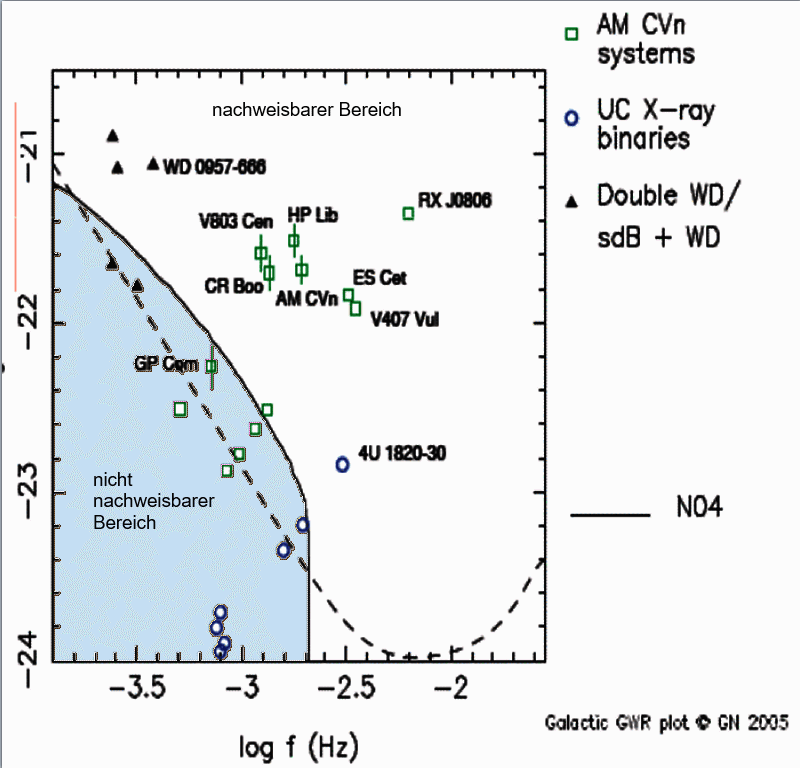
Im
Vorfeld gab es daher Untersuchungen welche der
bereits bekannten Systeme für die Kalibration des
LISA-Detektors geeignet sein könnten.
Dabei kamen etwa ein Dutzend Sternsysteme in die engere Auswahl.
Es lohnt sich diese interessanten Objekte etwas genauer zu untersuchen.
Auch mit Amateurmitteln könnten da spannende Effekte sichtbar
sein.
4 Zielobjekte sind doppelte Weiße Zwerge (WD). 2 weitere sind
ein Kombination aus WD und und blauen Unterzwergen (sdB).
Blaue Unterzwerge sind Rote Riesen die ihre Wasserstoffhülle
verloren haben und bei denen nur noch der heiße Kern sichtbar
ist.
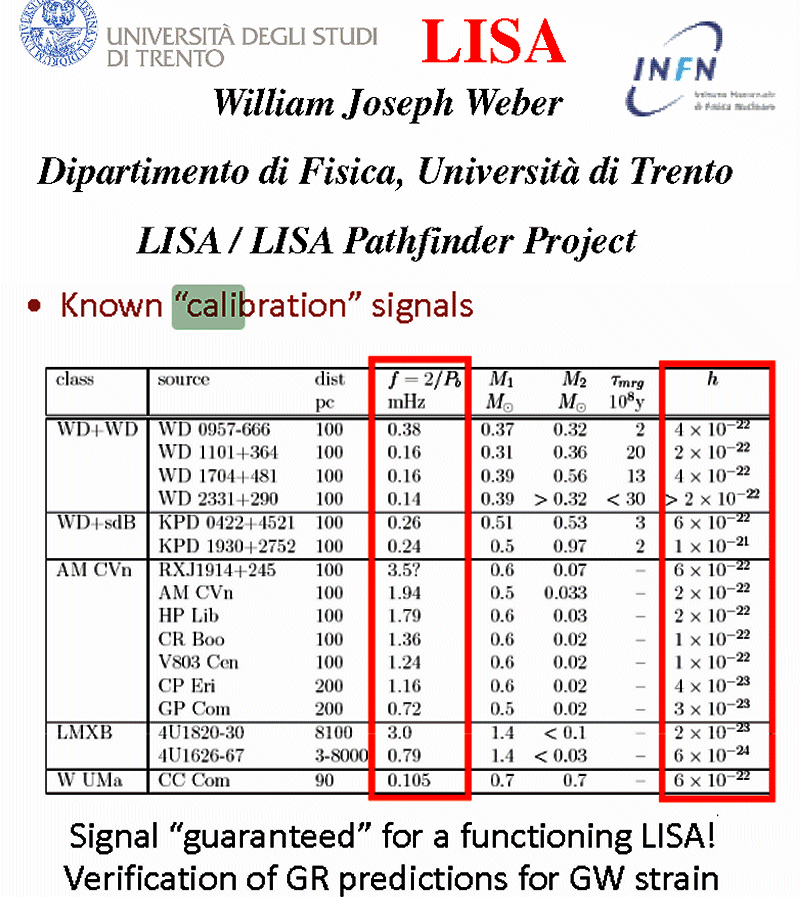
Die
größte Gruppe sind die
AM-Canum-Venaticorum-Sterne.
Das sind sind kompakte enge Doppelsternsysteme, bestehend aus einem
akkretierenden Weißen Zwerg und einem weiteren entarteten
Begleiter bei denen aktuell ein Massentransfer stattfindet.
Diese Objekte haben oft sehr unregelmäßige
Helligkeitsverläufe, was den Nachweis
von Perioden erschwert.
2 Zielobjekte werden als Röntgendoppelsterne gelistet (LMXB).
Visuell haben die 18mag und sind in der südlichen
Hemisphäre zu finden.
Auf der Liste steht dann noch CC Comae Berenices.
Das ist ein Doppelsternenpaar in
Oberflächenkontakt mit einem kontinuierlichen Lichtwechsel.
Die beiden K-Sterne sind von einer gemeinsamen Hülle
umgeben, die sich
zwischen der inneren
und der äußeren Roche-Grenze gebildet hat. CC Com
gehört zu den W-Ursae-Majoris-Sternen. Periode 0.2206874,
Delta 0.8mag, Helligkeit11.3
mag.
Die obige Liste ist eher konservativ gerechnet. Die Nachweisgrenze ist
nach unten schwer abzugrenzen. Andere Autoren nehmen weitere Objekte
hinzu.
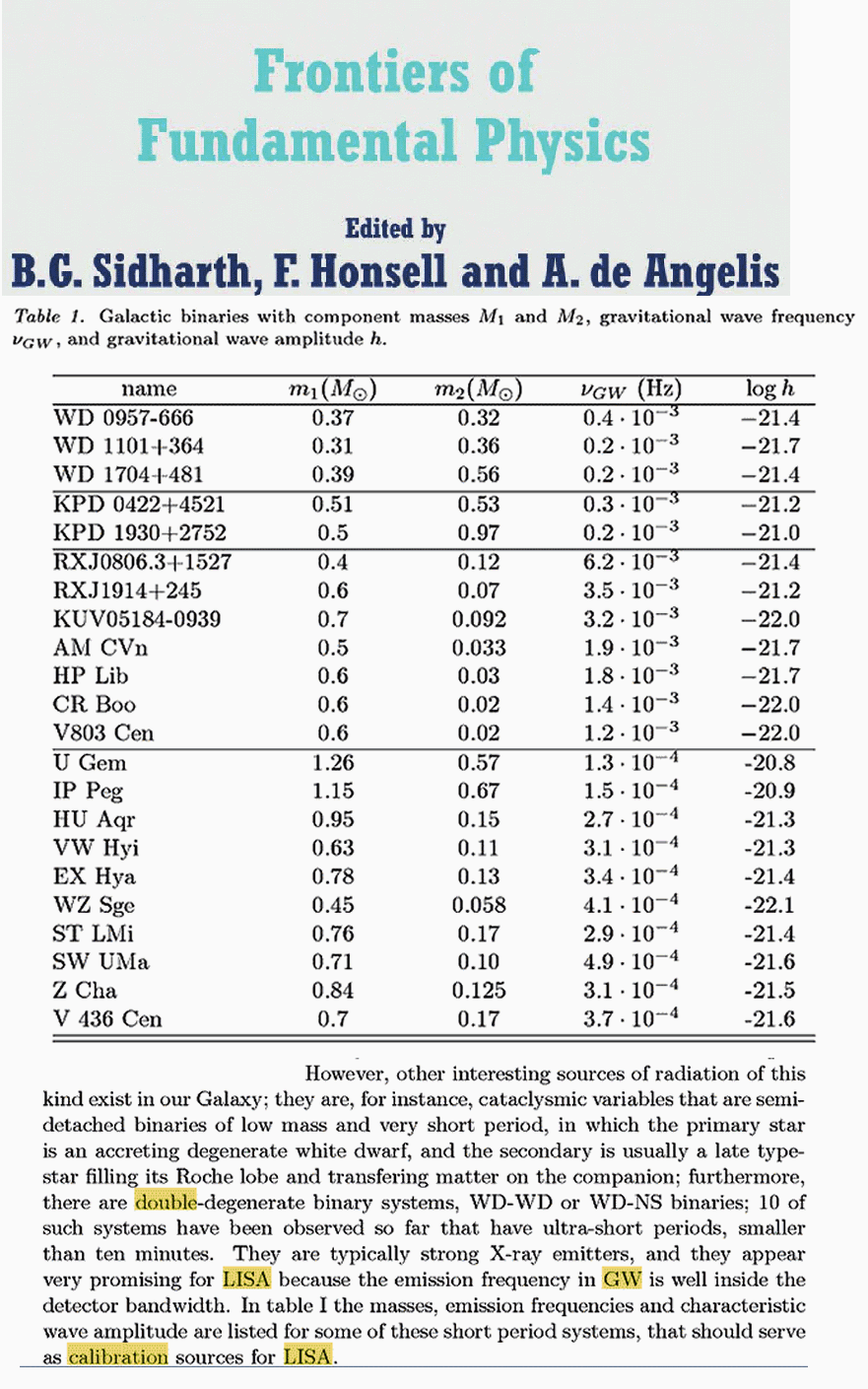
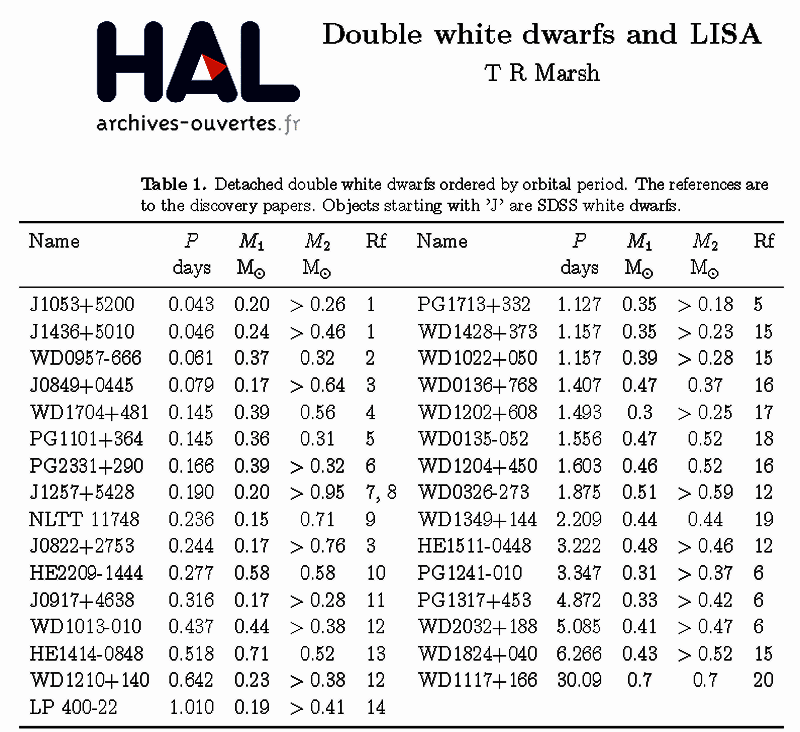
Der erste Stern der genauer untersucht wurde war HP Lib.
Laut https://iopscience.iop.org/article/10.1086/339450/pdf
hat der 13,7mag helle Stern bei 15:35:53.1 und -14:13:12.2 eine Periode
von 1119s mit einer Helligkeitsänderung von max 8%. Die
Schwankungen sind relativ regelmäßig. Es gibt aber
auch
Ausbrüche in Form von Superhumps. Die Angaben zur Periode sind
widersprüchlich. Einige Quellen nennen auch 1102s.
Möglicherweise überlagern sich mehrere Perioden.
Ursächlich ist dabei schon die Umlaufzeit des Doppelsterns. Zu
einer Bedeckung kommt es dabei nicht, da die Bahnebene nicht auf der
Sichtachse der Erde liegt. Es ist schon eine irre
Vorstellung das sich
hier 2 Sterne in
weniger als 20 min umkreisen.
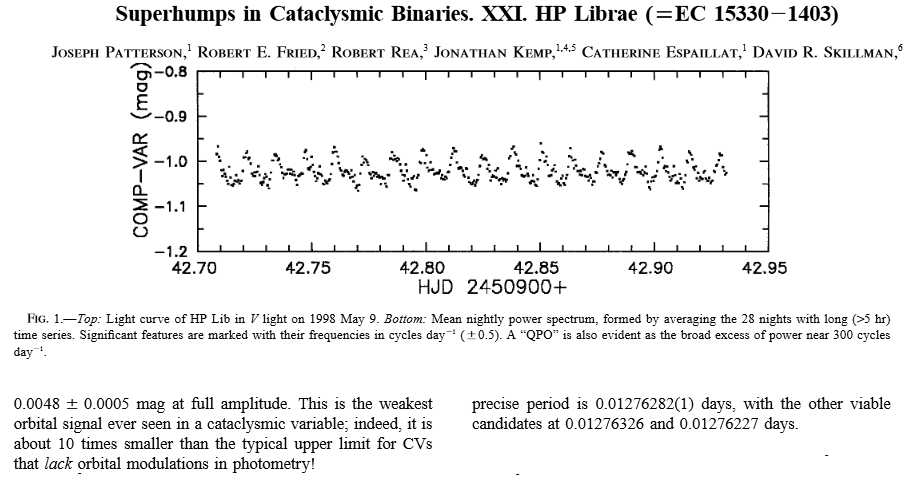
Die
obige Grafik sieht
Schwankungen im Bereich von 0,8mag. Auf 0,1 Tag lassen sich 8
Maxima zählen. Eine Periode enthält 2 Maxima also
1119 s bzw. 18,65min kommen gut hin. Die eigene Messung erstreckt sich
über etwa 40 Minuten. Es sind signifikante
Helligkeitsänderungen mit der passenden
Amplitude und
Länge zu sehen, doch schön
gleichmäßig ist die Kurve nicht.
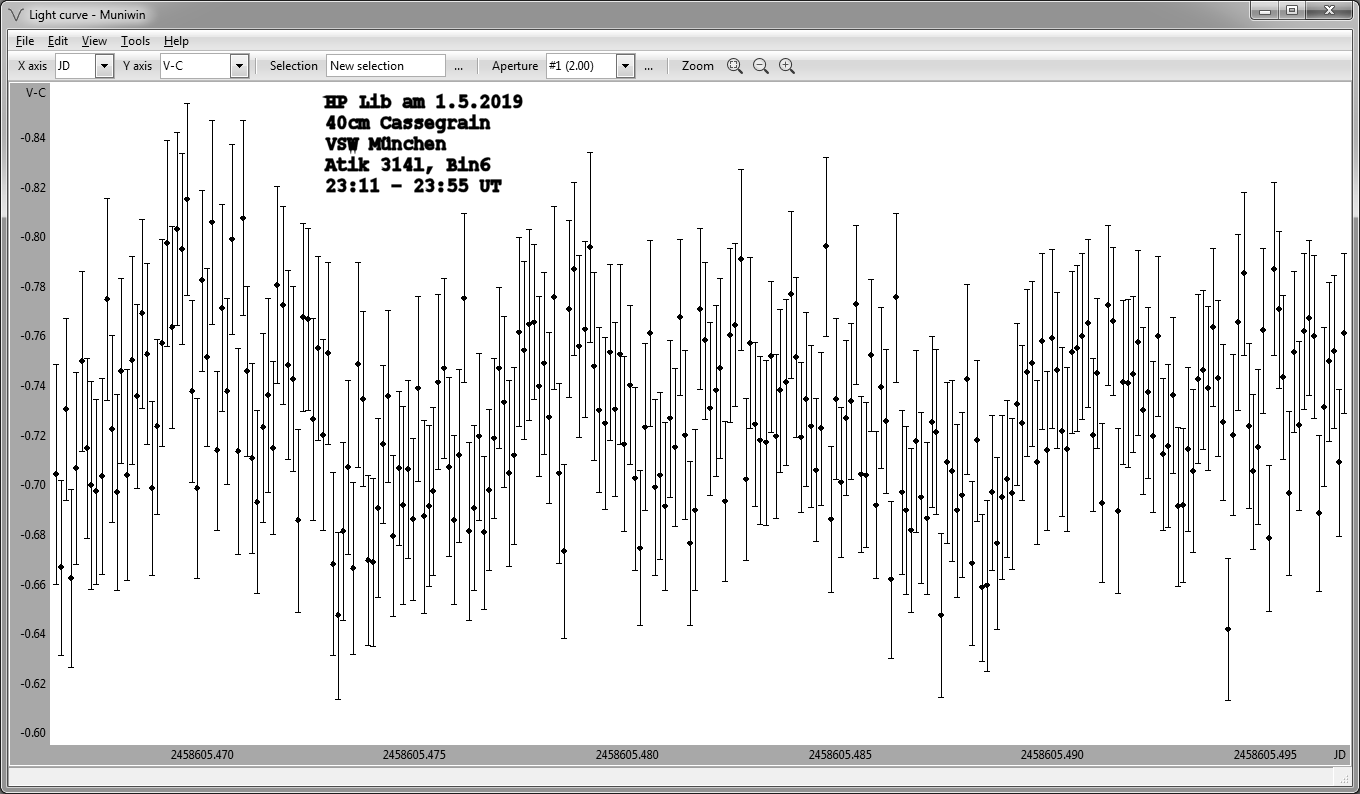
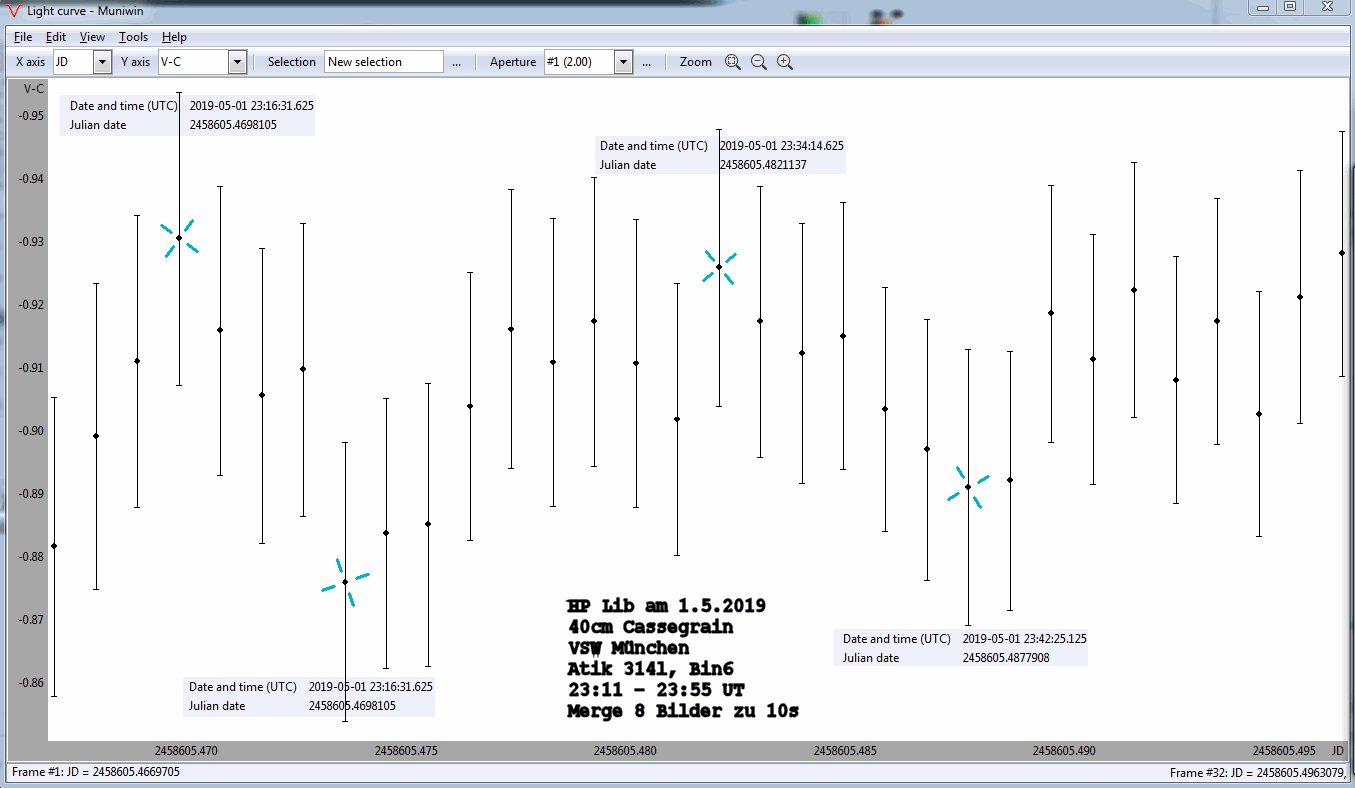
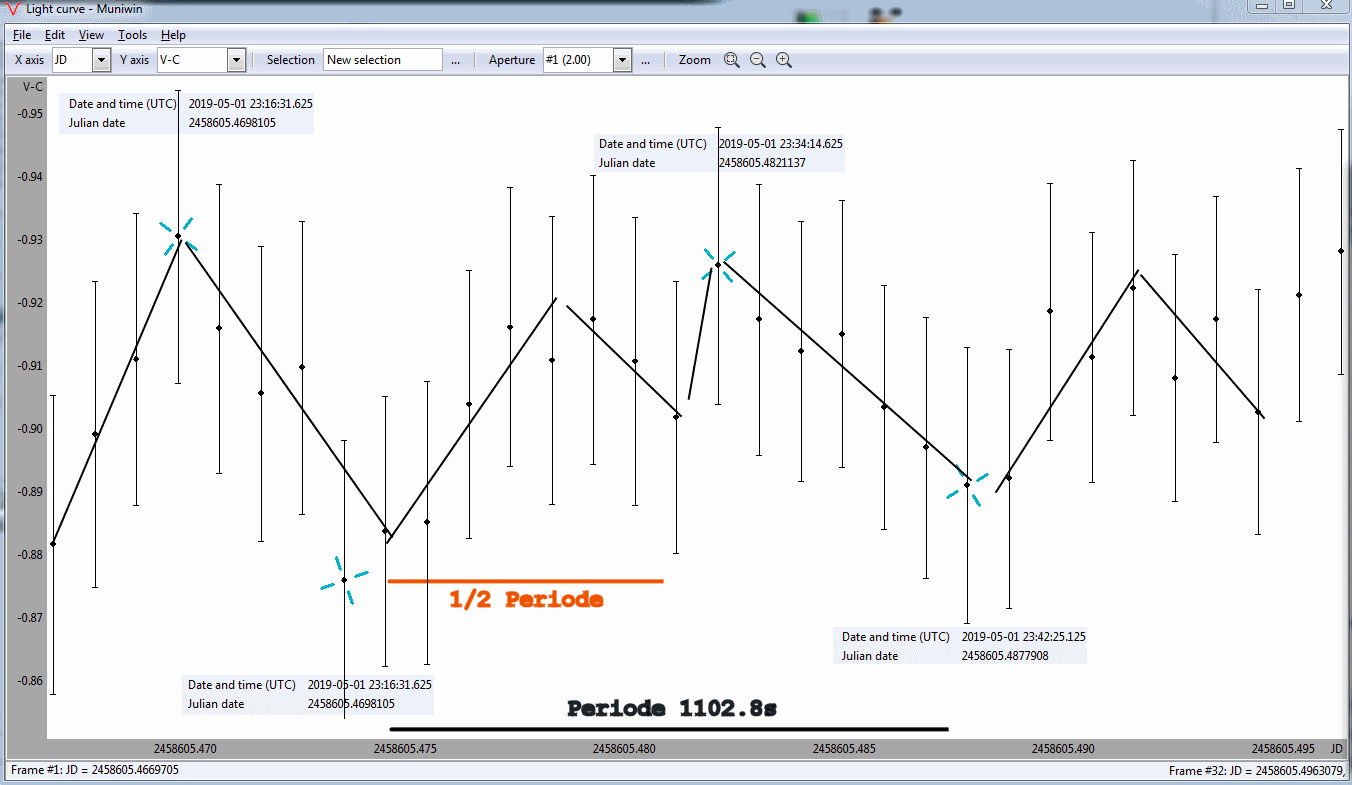
Nicht alle Messungen sind gleichermaßen erfolgreich. Kein
klares Signal gab es bei
GP-Com der eine Periode von 2794.05s, also etwa 46 min haben sollte.
Visuell war davon nichts zu sehen.
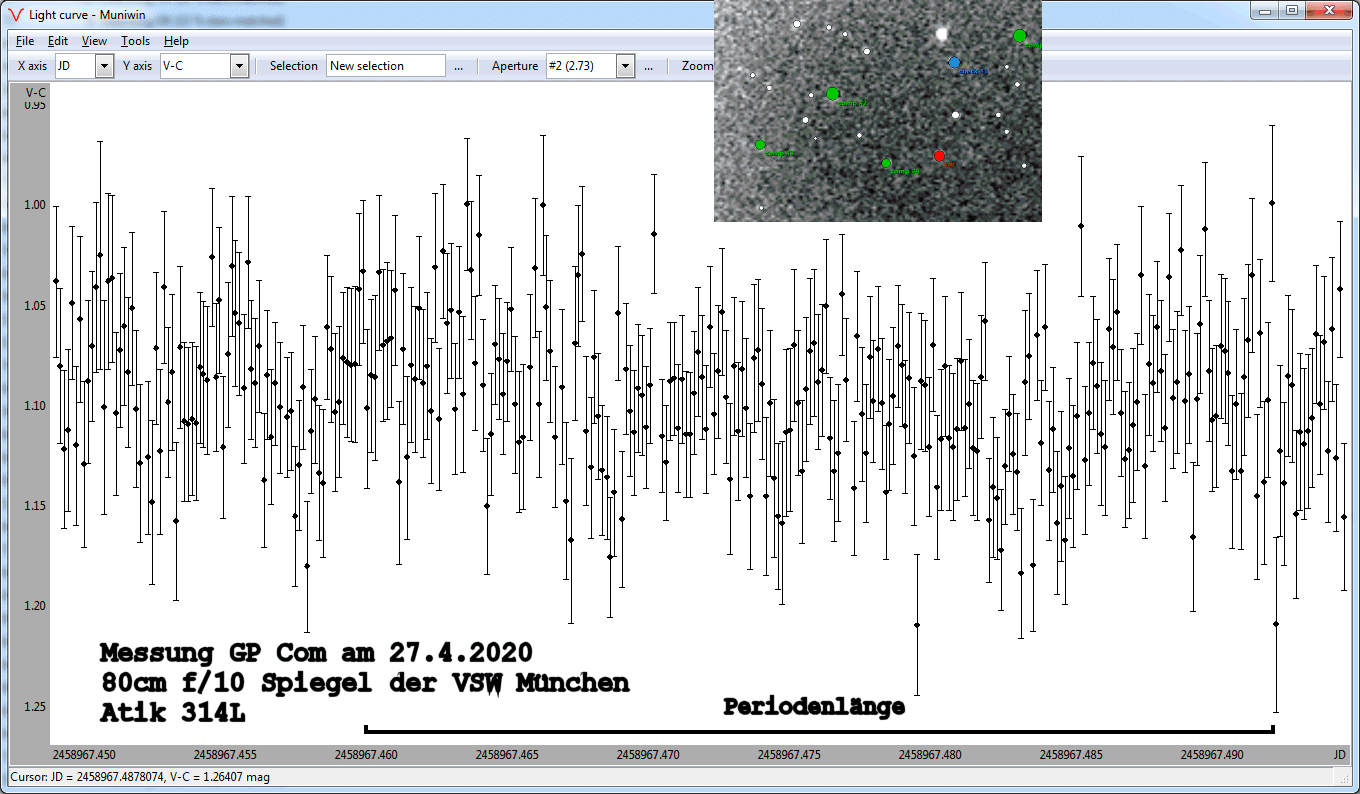
RXJ1914+245 auch V407 Vulwird bei:
https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/astro/theses/SusanaBarros.pdf
im UV mit einer Aamplitude von 20% und im Grün von
8% angegeben. Mit einem Blaufilter wäre da also schon was zu
erwarten.
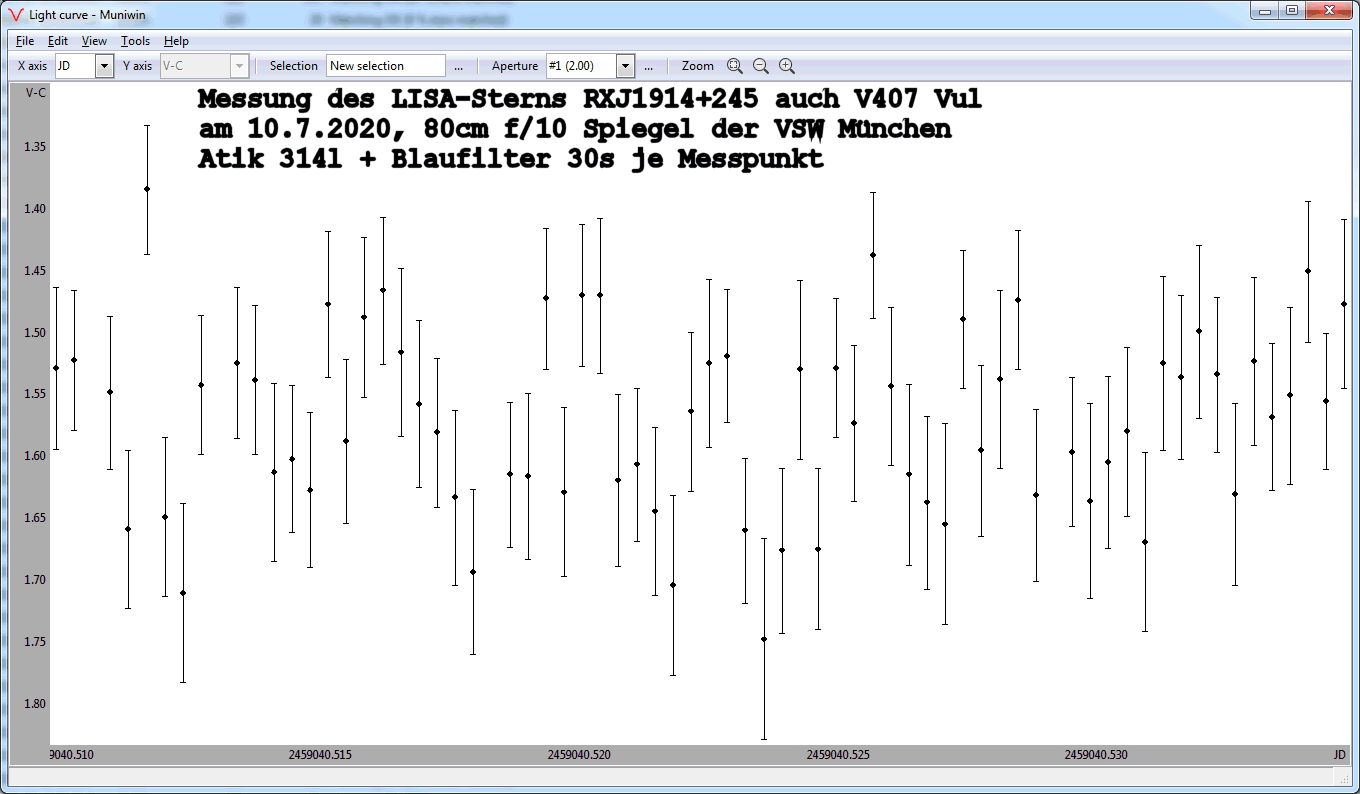
Im Vergleich zu einem ähnlich hellen Feldstern war jedoch
allenfalls eine geringe Variablilität sichtbar.
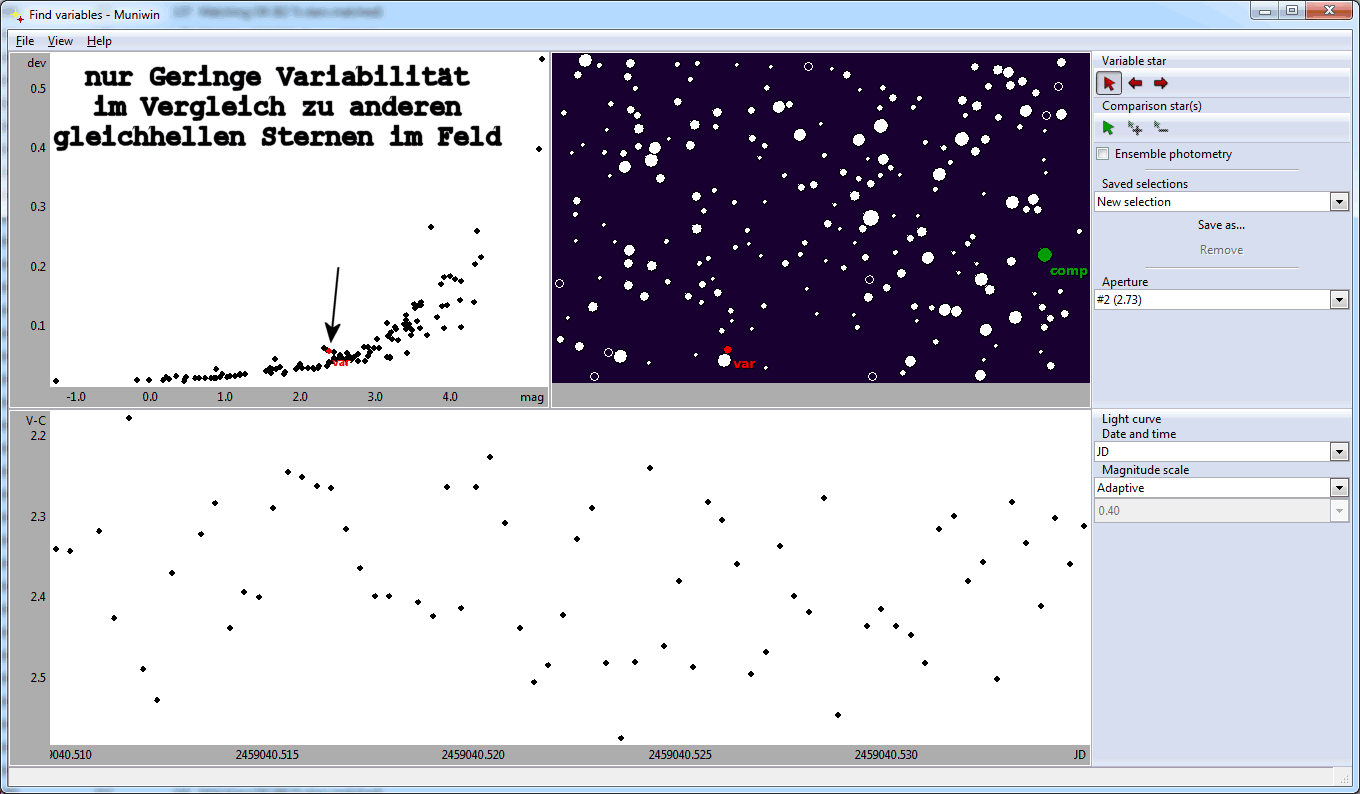
AM
CVn ist ein Unterriese mit Zwergstern.
Er wird auch als auch HZ-29 geführt:
HP
Lib:
https://de.wikipedia.org/wiki/AM-Canum-Venaticorum-Stern
Die Amplitude wird mit
ca 20% gelistet und
die Periode mit
17,5min:
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1978BAAS...10..419P&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1975AcA....25..371S&data_type=PDF_HIGH&whole_paper=YES&type=PRINTER&filetype=.pdf
Der Sern ist bekannt für seinen sehr
unregemmäßigen Helligkeitsverlauf. Gemessen wurde
nichts eindeutiges:
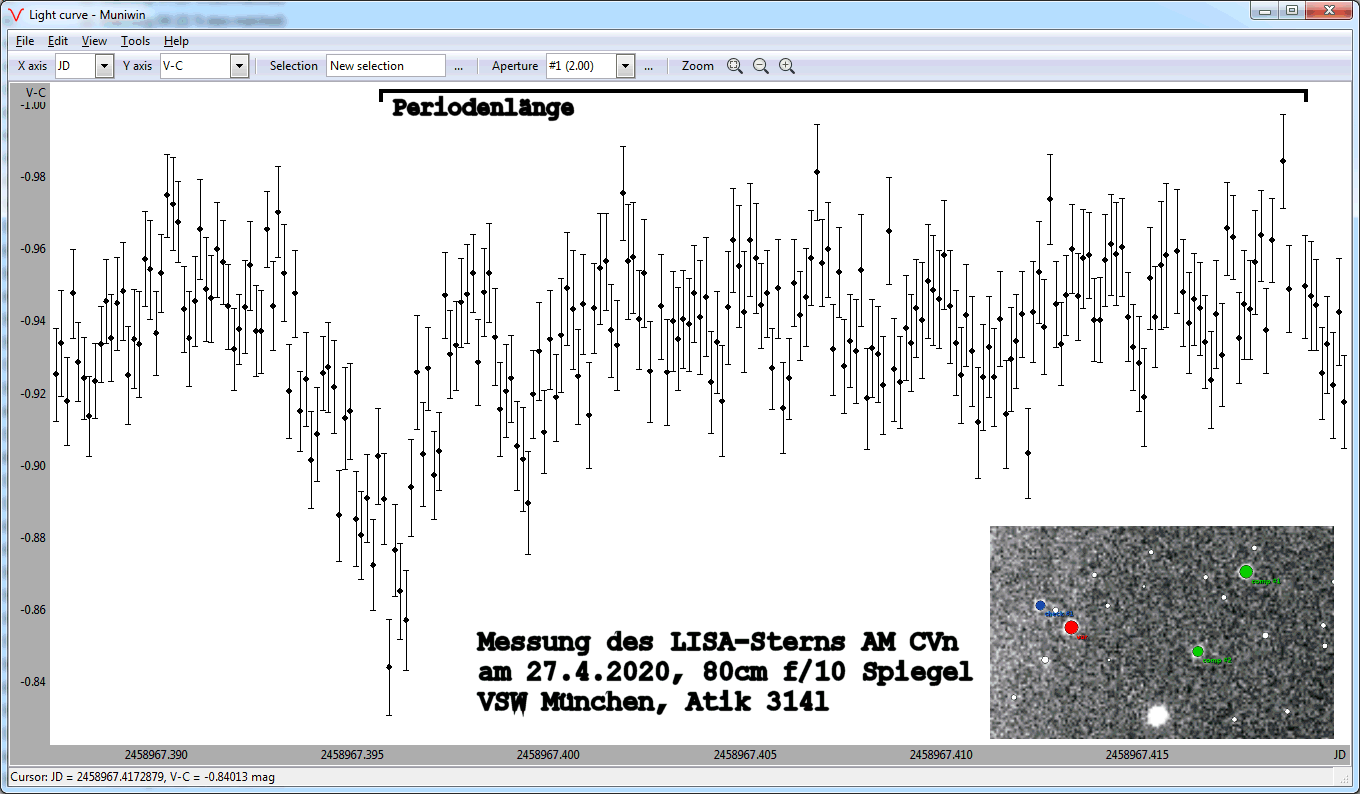

HP
Lib:
https://iopscience.iop.org/article/10.1086/339450/pdf
LISA-Prüfsterne
I: http://moriond.in2p3.fr/J07/trans/tuesday/vitale.pdf
LISA-Prüfsterne
II:
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~soichiro.isoyama/CAPRA/CAPRA_2008/08_Jennrich.pdf
Liste
Weißer Zwerge:
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/docs/theses/2006-10_Richter.pdf