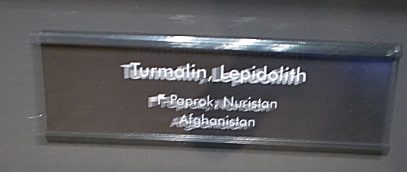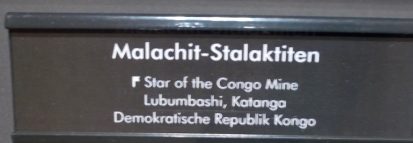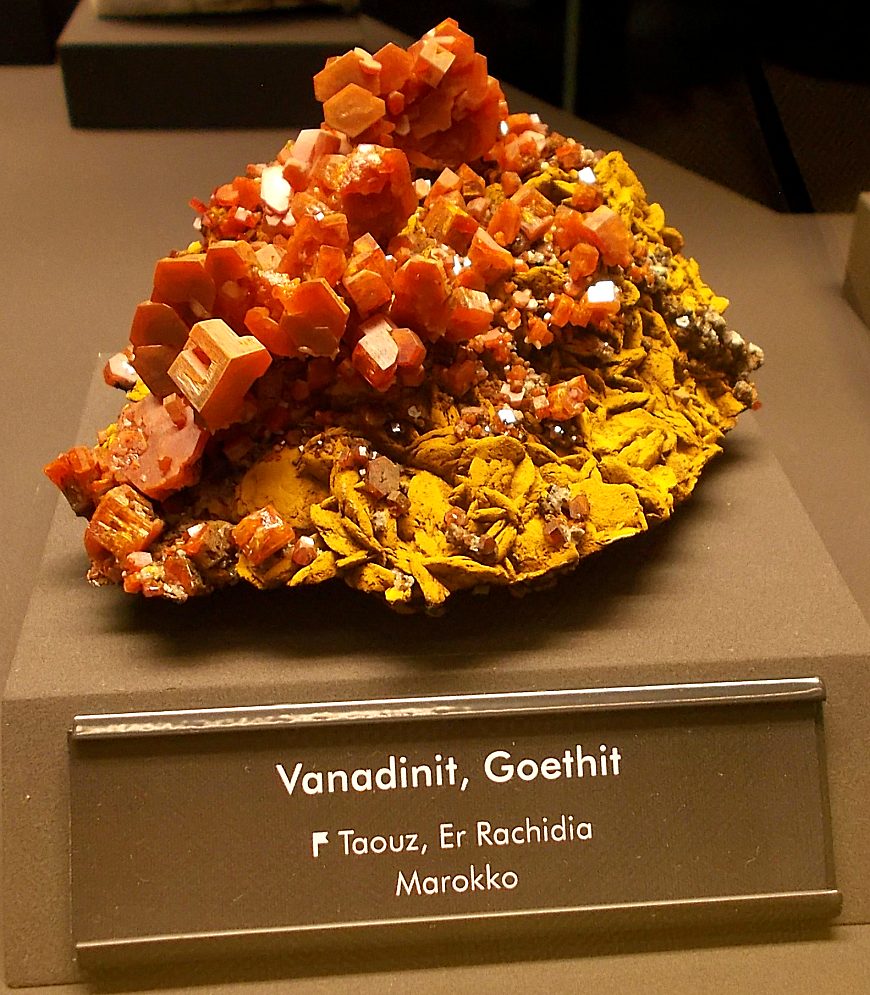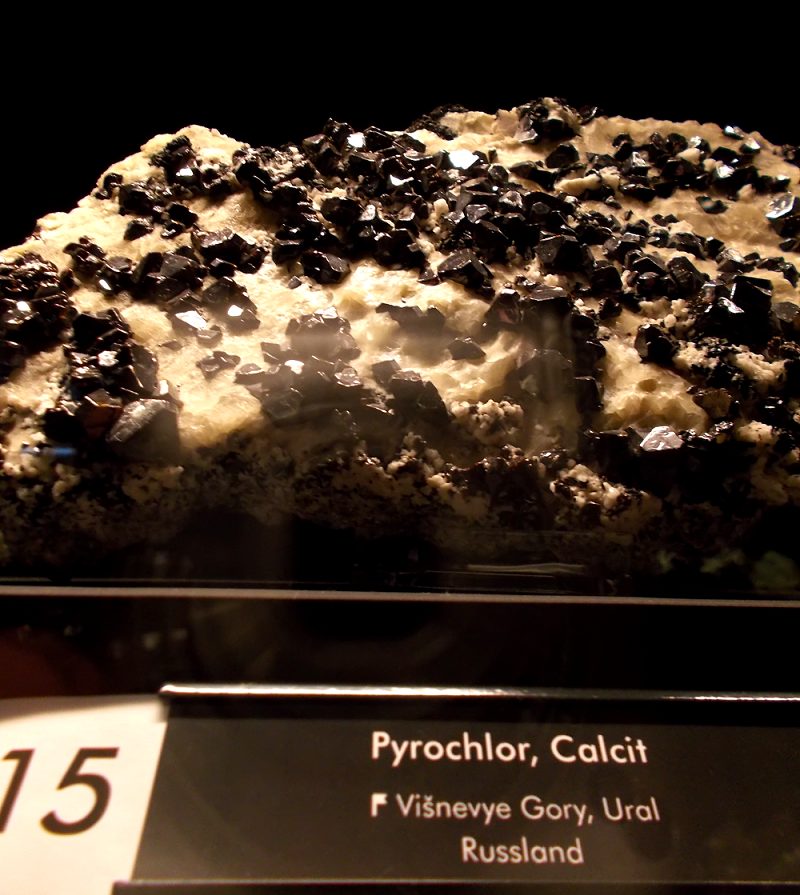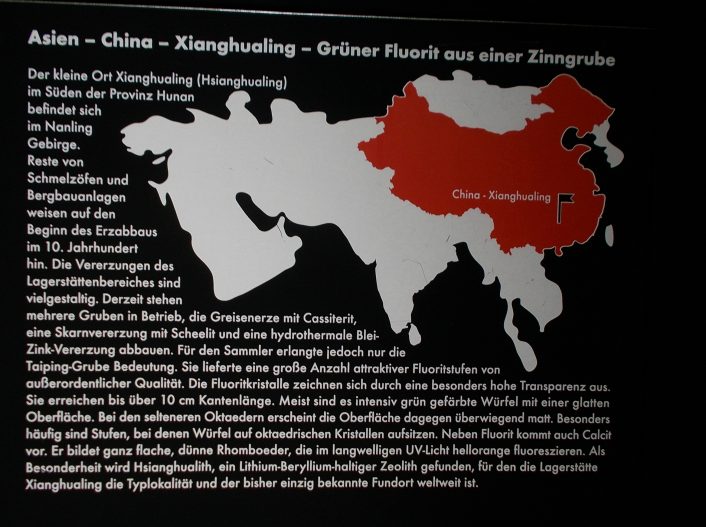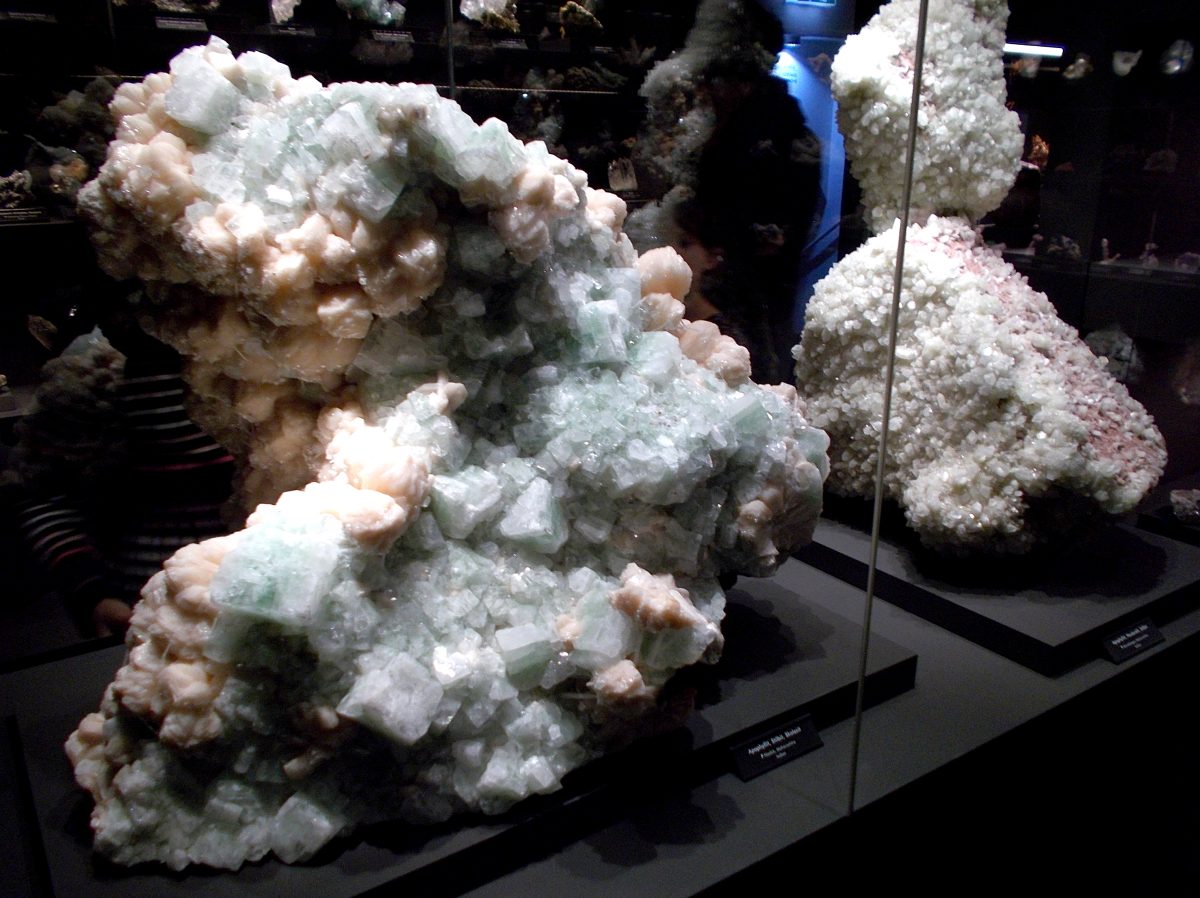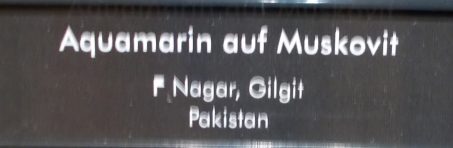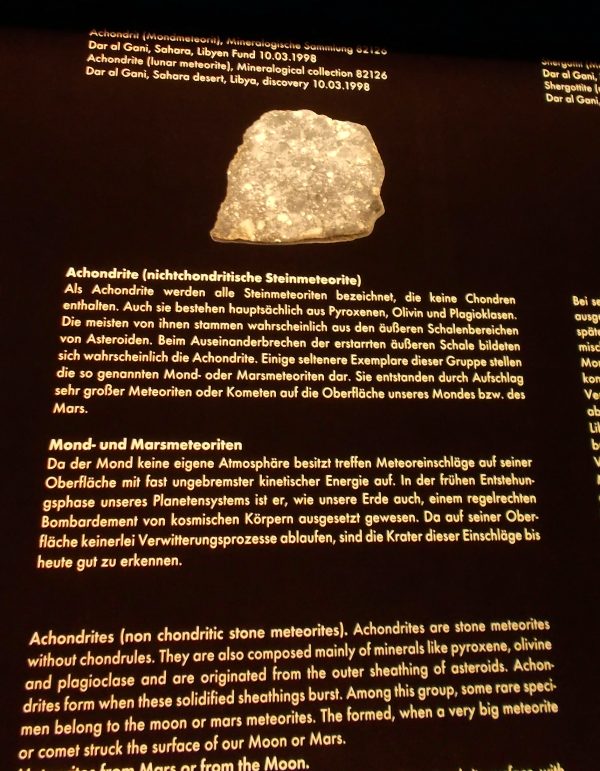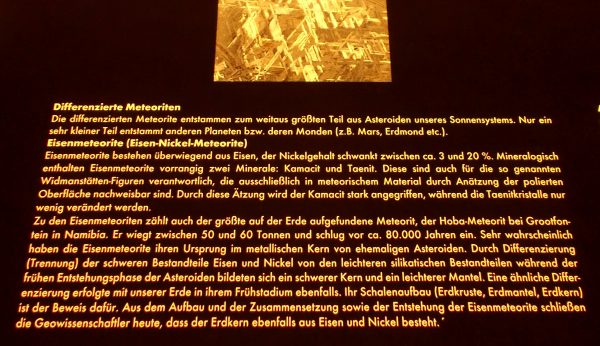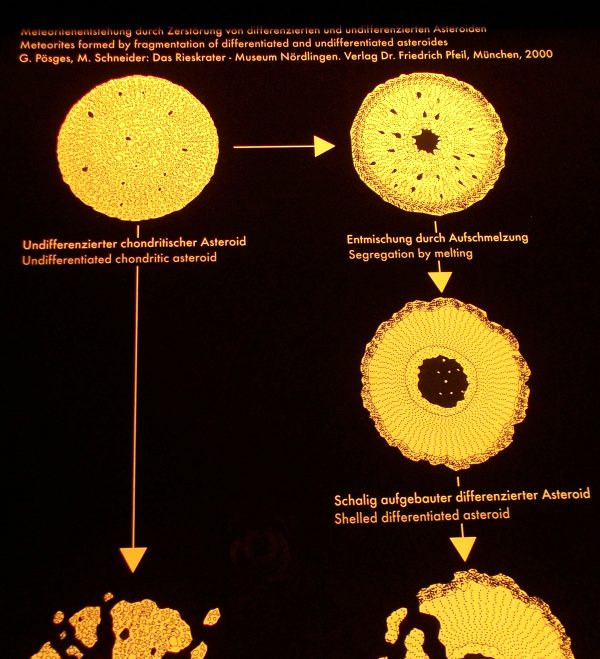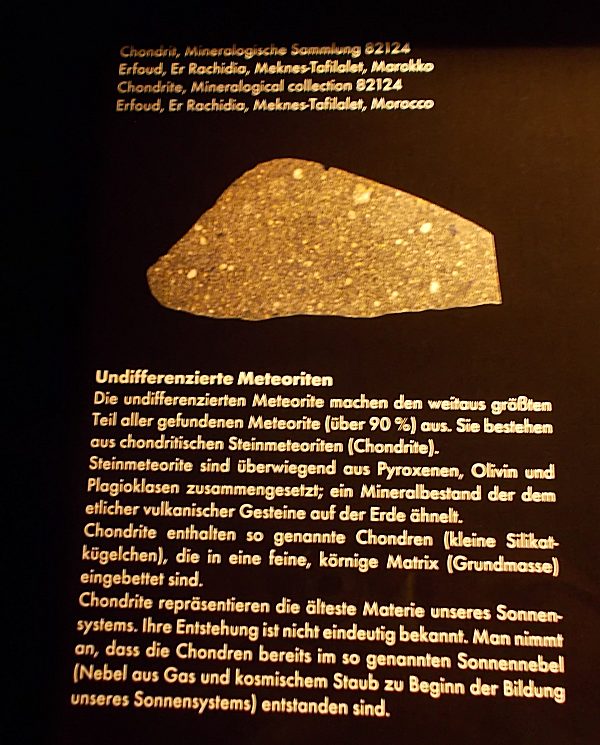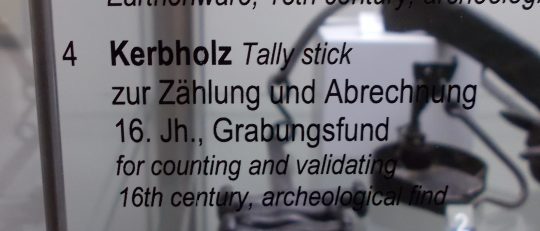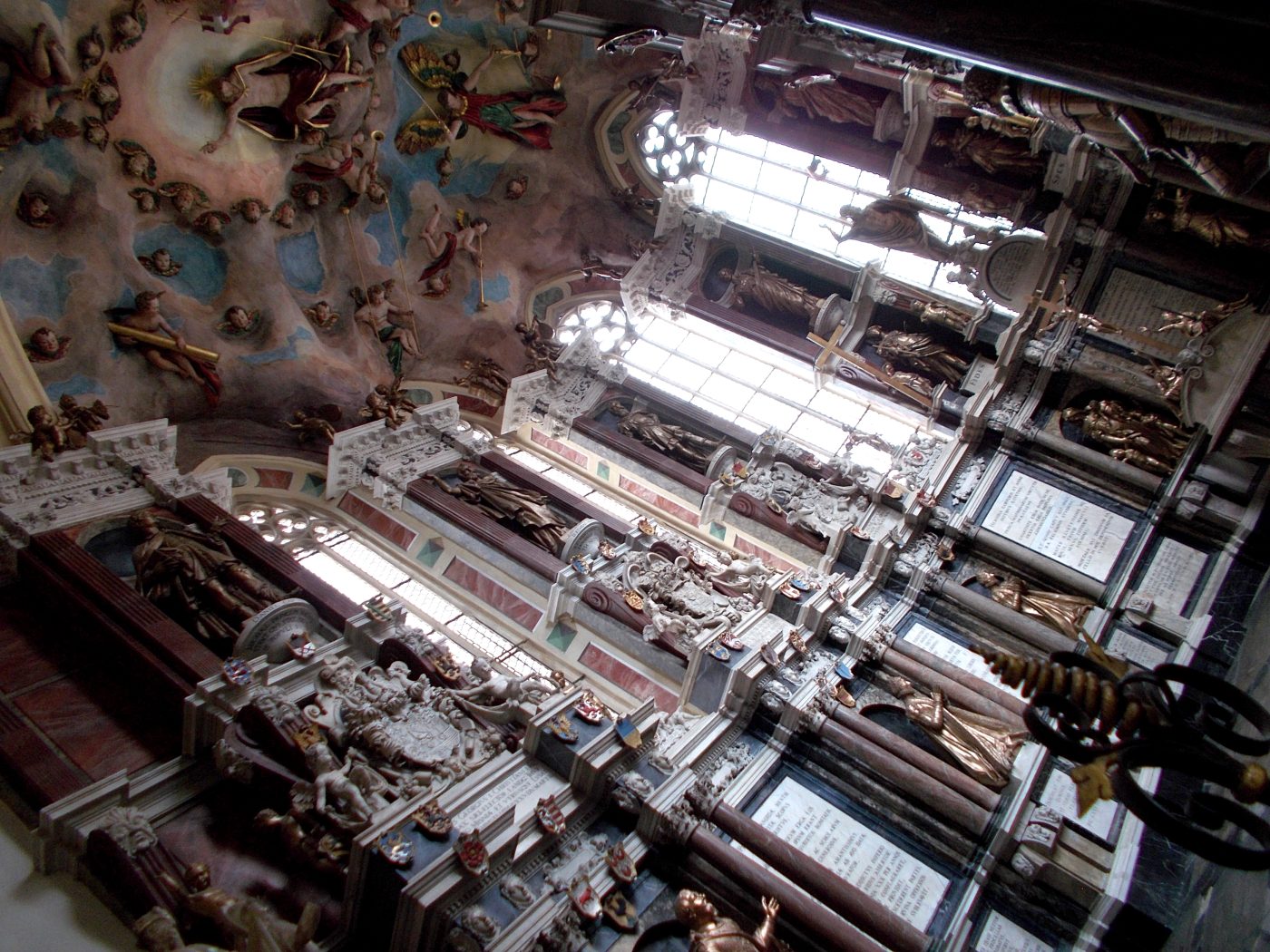ESOP 2017 II

Die ESOP 2017 fand in Freiberg statt. Die Bergbaustadt hat
eine reiche Geschichte und touristisch einiges zu bieten. Der gesamte
historische Stadtkern steht unter Denkmalschutz. Zahlreiche
Gebäude sind ausgewählte Objekte für die
vorgesehene Kandidatur zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge. Bis
1969 war die Stadt rund 800 Jahre vom Bergbau und der
Hüttenindustrie geprägt. Die Erzgänge waren
vom Hochmittelalter bis in das zweite Drittel des 20. Jahrhunderts
Gegenstand bergmännischen Abbaus, wobei Silber die
überwiegende Gewinnungskomponente war.
Der
Bergbau prägte den Charakter und die Bedeutung der Stadt
Freiberg nachhaltig. Der östlich der
Hauptstraßenachse gelegene Teil wird als Unterstadt mit dem
dazugehörenden Untermarkt bezeichnet. Das westliche Gebiet ist
die Oberstadt mit dem Obermarkt. Der Stadtkern wird von den entlang der
alten Stadtmauer verlaufenden Ringanlagen umschlossen.




Die Fenster der zahlreichen gotischen Häuser zeigen einen
einheitlichen Stil in den Fensterlaibungen. Die Stadt wurde nach einem
großen Brand im 15Jh. fast komplett neu aufgebaut.



Unmittelbar
nördlich des Stadtkerns befinden sich Schloss Freudenstein.
Dort ist eine der weltweit besten Mineraliensammlungen
untergebracht.

Die etwa achtzigtausend Exponate
umfassende
Mineraliensammlung wurde am 30. Juni 2004 durch einen Vertrag
der Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe überlassen. Dem
Vertrag vorausgegangen war die Gründung der
Pohl-Ströher-Mineralienstiftung 2004 in der Schweiz.
Bestandteil des Vertrages, der mit dem Rektor der Bergakademie Georg
Unland geschlossen wurde, war die Auflage, einen Teil der privaten
Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
In
der ersten Abteilung sind ausgewählte Mineralstufen aus
Amerika ausgestellt. Die Themenausstellung Amerika steht unter dem
konzeptionellen Motto „Reise ins Licht“. Den
Abschluss dieser Abteilung bildet ein separater Raum, in dem
lumineszierende, das bedeutet fluoreszierende und phosphoreszierende,
Minerale ausgestellt und zum Leuchten angeregt werden.
In mehreren Ausstellungsvitrinen und interaktiven Exponaten werden
Grundkenntnisse zum Aufbau von Mineralen und der Kristallchemie
vermittelt.


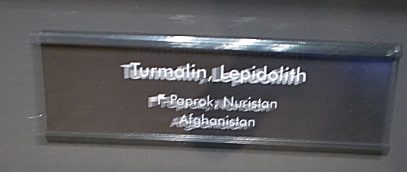

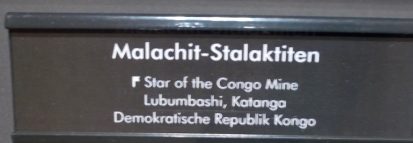












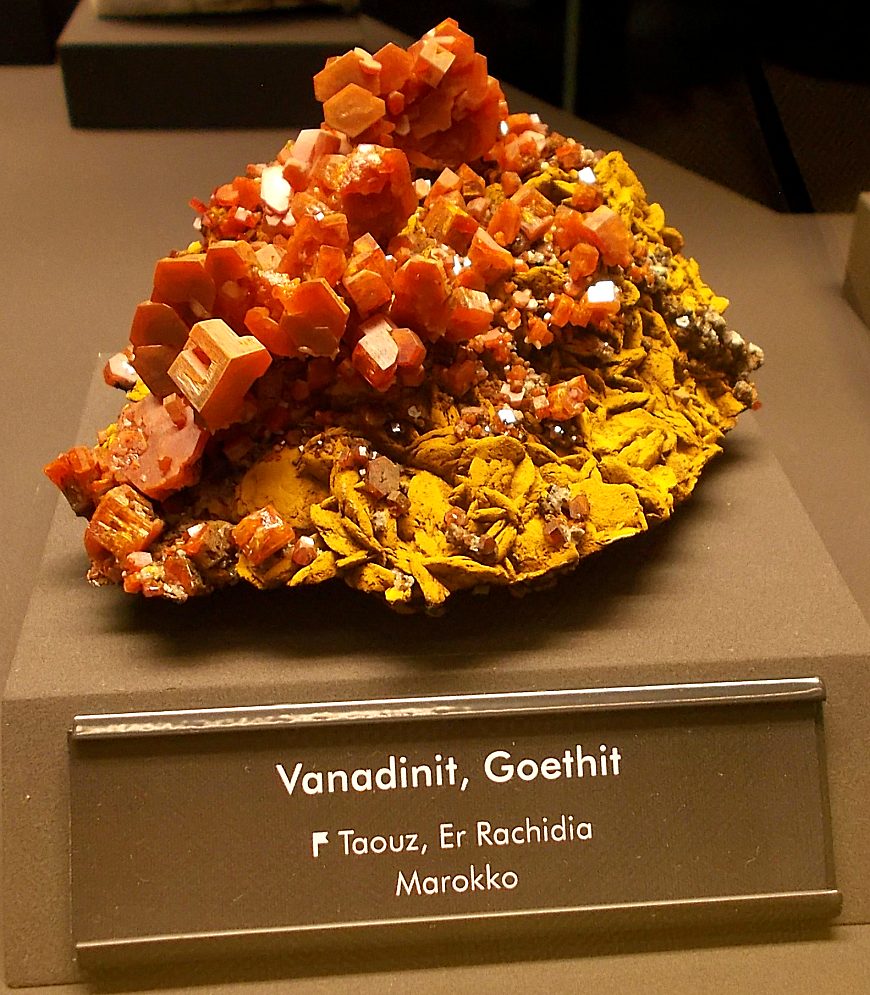
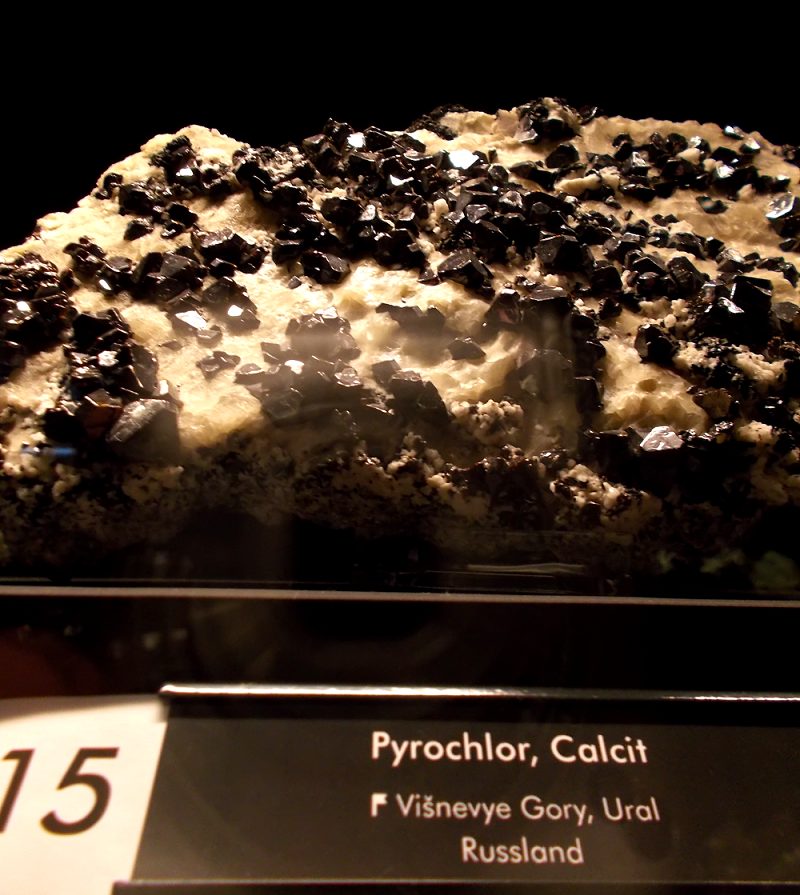










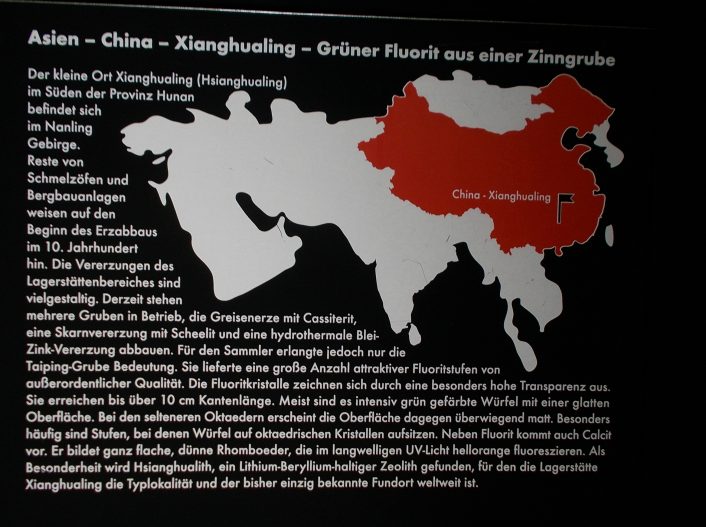


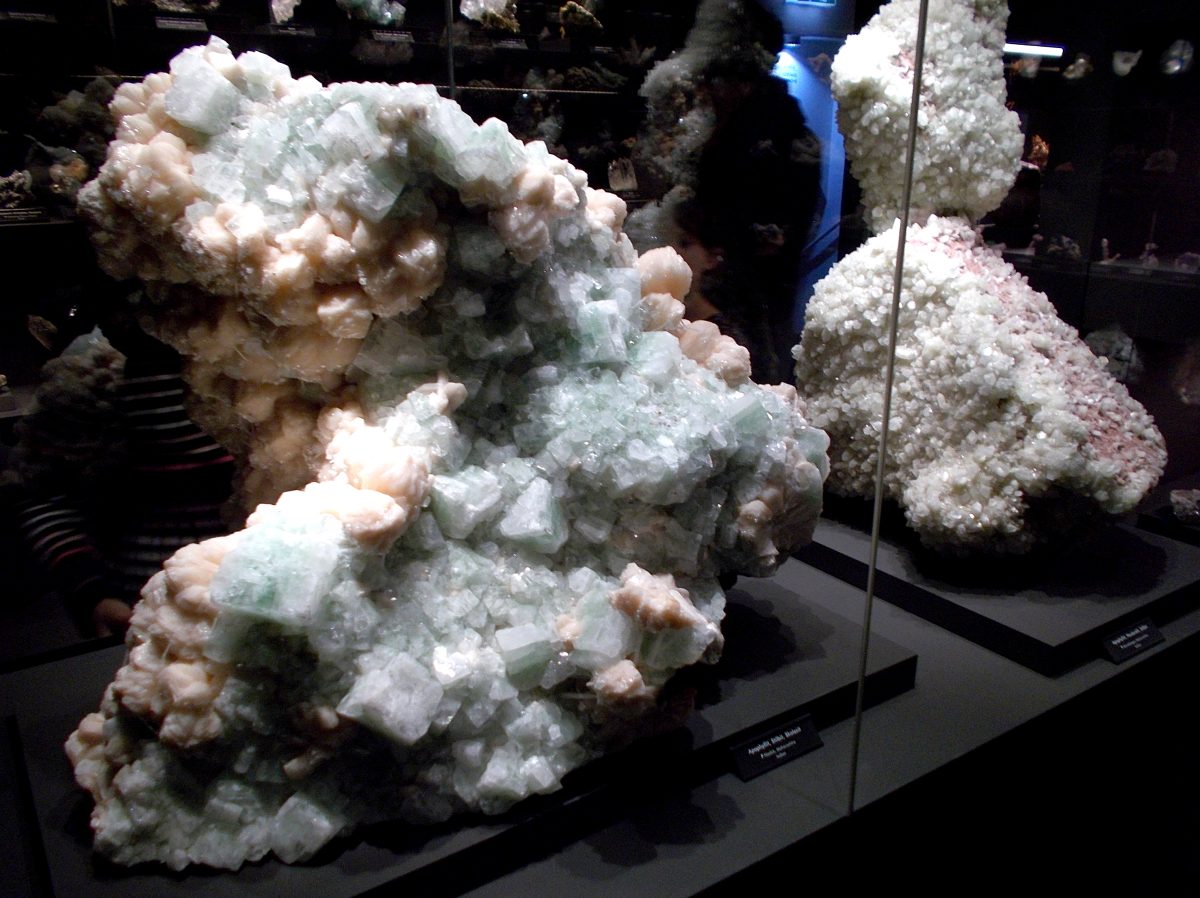
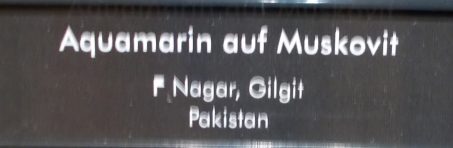
Den
Höhepunkt der Terra Mineralia bildet die sich im Erdgeschoss
befindende „Schatzkammer“, die aus mehreren
Räumen besteht. Im so genannten
„Tresorraum“ werden vor allem zum Teil bearbeitete
Schmuck- und Edelsteine ausgestellt. Der Hauptraum der Schatzkammer
befindet sich in der ehemaligen Schlossküche. Hier werden in
erster Linie repräsentative Großstufen in
Einzelvitrinen gezeigt.

Der „Meteoritenraum“
widmet
sich Mineralen und Gesteinen, die auf kosmischen Ursprung
zurückgehen oder durch Einwirkung von Meteoriten entstanden
sind. Neben einer Sammlung von Tektiten und verschiedenen, zum Teil
angeschliffenen Meteoriten bilden acht geschliffene
Impakt-Gesteinsplatten aus dem Vredefort-Meteoritenkrater den
Höhepunkt dieser kleinen Spezialausstellung.


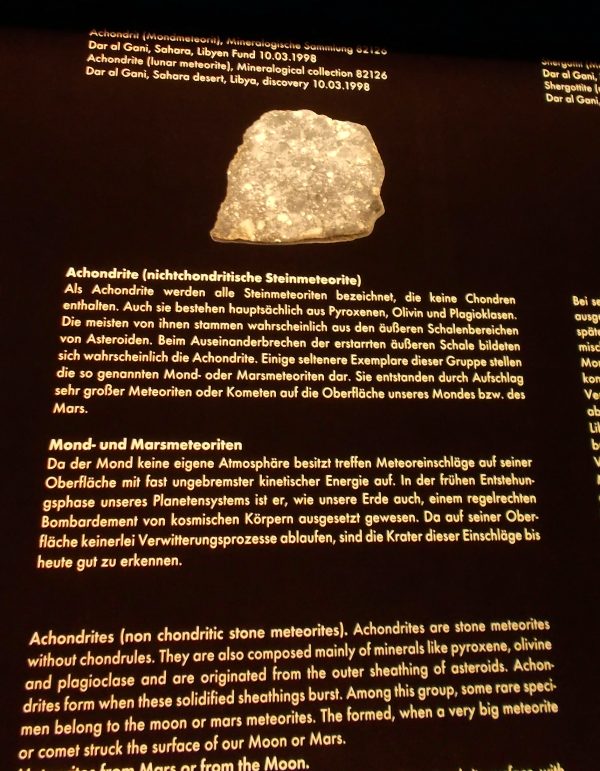
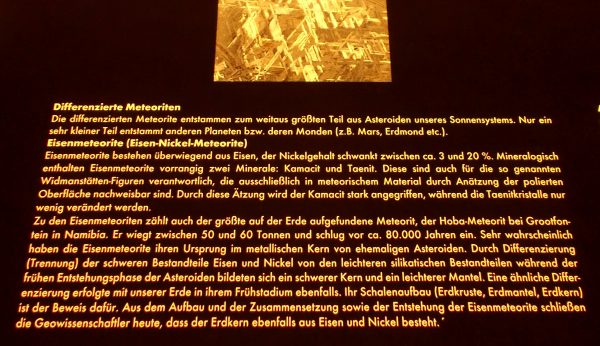
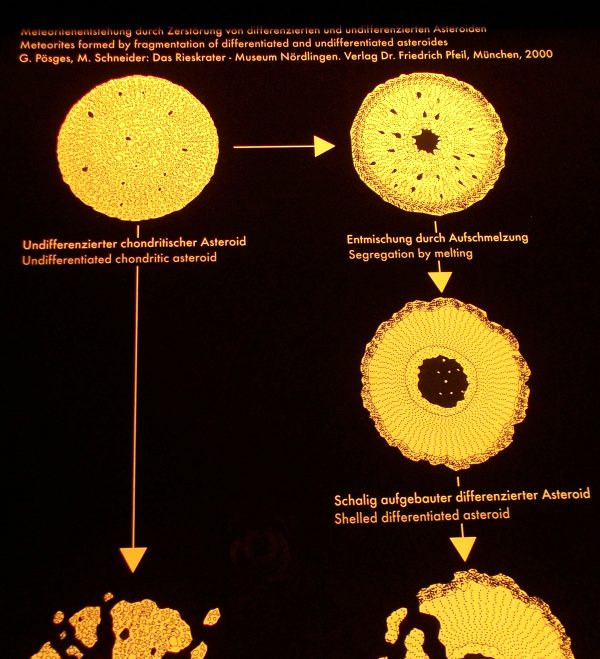
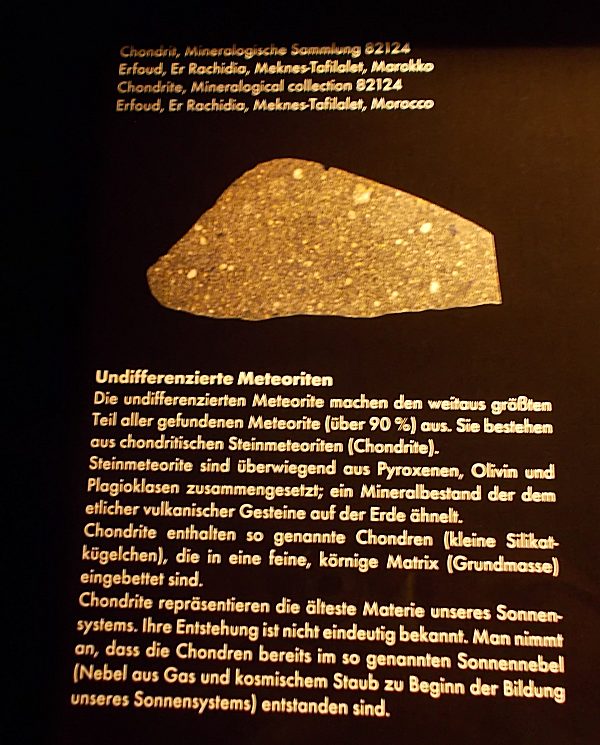



Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
im ehemaligen Domherrenhof, einem
spätgotischen Profanbau, zählt zu den
ältesten bürgerlichen Museen Sachsens.





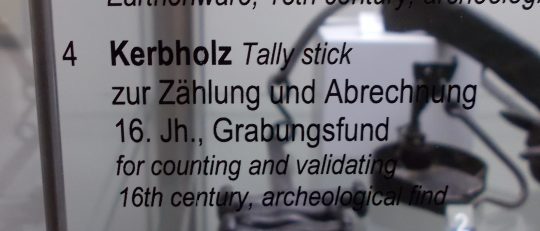
Der Dom St. Marien war vor der
Reformation war das Gotteshaus eine
Stiftskirche, eine Bischofskirche war es nie. Die
Kirche wurde während eines großen
Stadtbrandes 1484 fast völlig zerstört. Der heutige
Bau ist eine
spätgotische Hallenkirche.
Ungeachtet
dessen ist der Freiberger Dom eines der am reichsten ausgestatteten
Gotteshäuser Sachsens und enthält mit der Goldenen
Pforte, der Tulpenkanzel, den Orgeln Gottfried Silbermanns und dem zur
Begräbnisstätte der Albertiner umgestalteten Chor
bedeutende Kunstwerke.

Die Fürstenloge zeigt das polnische Königswappen August
des Starken.


Die Kirche hat 2 Silbermann-Orgeln!





Die Goldene Pforte im Freiberger Dom ist ein spätromanisches,
1225 geschaffenes Rundbogen-Sandsteinportal an der Südseite
des Domes. Sie
ist das erste vollständige deutsche
Statuenportal. Das Tympanon zeigt die thronende Muttergottes mit den
anbetenden Heiligen Drei Königen, einen Engel und Joseph; am
Gewände
stehen Statuen von alttestamentlichen Vorläufern, in den
Archivolten in
vier Zonen Gestalten zur Darstellung von Erlösung und
Jüngstem Gericht.
Ursprünglich
wies das Portal eine reiche farbige Fassung auf.


Zum Schutz des Portals vor
Umwelteinflüssen wurde 1902/03 ein
Vorbau
errichtet, der die gotische Formensprache mit dem damals modernen
Jugendstil verband.

Die Tulpenkanzel ist eines der
bekanntesten Kunstwerke des Domes. Dieser hohe Predigtstuhl wird auch
als Festtagskanzel bezeichnet. Sie entstand wahrscheinlich zwischen
1505 und 1510.


Die Tulpenkanzel wird weder von einer
Wand noch durch Pfeiler gestützt und so scheint es, als würde
dieses
Meisterwerk wie ein Blütenkelch mit 4 Stängeln aus dem Boden
wachsen.
Diese Stängel sind zweimal mit Stricken an den inneren Schaft
gebunden.
Zwischen beiden Verschnürungen spielen singende Engelskinder. An
dem
Blütenkelch erscheinen die vier Kirchenväter Augustin als
Bischof,
Gregor als Papst, Ambrosius als Erzbischof und Hieronymos als Kardinal.
Die dominierenden Figuren sind ein vornehm gekleideter Mann (es
könnte
sich um eine Darstellung des Stifters der Kanzel handeln), am
Fuße der
Kanzel ruhend, von Löwen umgeben (es könnte Daniel, der
Schutzpatron
der Bergleute sein) und ein Knappe (es könnte sich um eine
Darstellung
des Meisters H.W. handeln), der die Last der Wendeltreppe auf seinen
Schultern trägt. Der Knappe sitzt auf einer Astgabel eines
Baumstammes
unterhalb des Treppenaufganges. Über dem Kanzelkorb schwebt ein
hölzerner Schalldeckel, bekrönt von einer Madonna, die mit
ihrem Kind
spielt.

Sanduhr zur Einhaltung der Predigtzeiten

Mit der Umgestaltung des gotischen Chores zur Grabkapelle beauftragte
der Kurfürst August von Sachsen den italienischen Bildhauer
Giovanni Maria Nosseni, der die Planung und Ausführung von 1589
bis 1595 leitete. Die Wand ist mit einer Fülle an Epitaphen und
Plastiken des Fürstenhauses geschmückt. Beeindruckend ist die
Deckengestaltung aus Malerei und Plastik im Stile des italienischen
Manierismus. Beachtenswert ist das mächtige Moritzmonument,
zu Ehren Moritz von Sachsen. Er errang durch seine Dienste für den
Kaiser die Kurwürde für Sachsen.
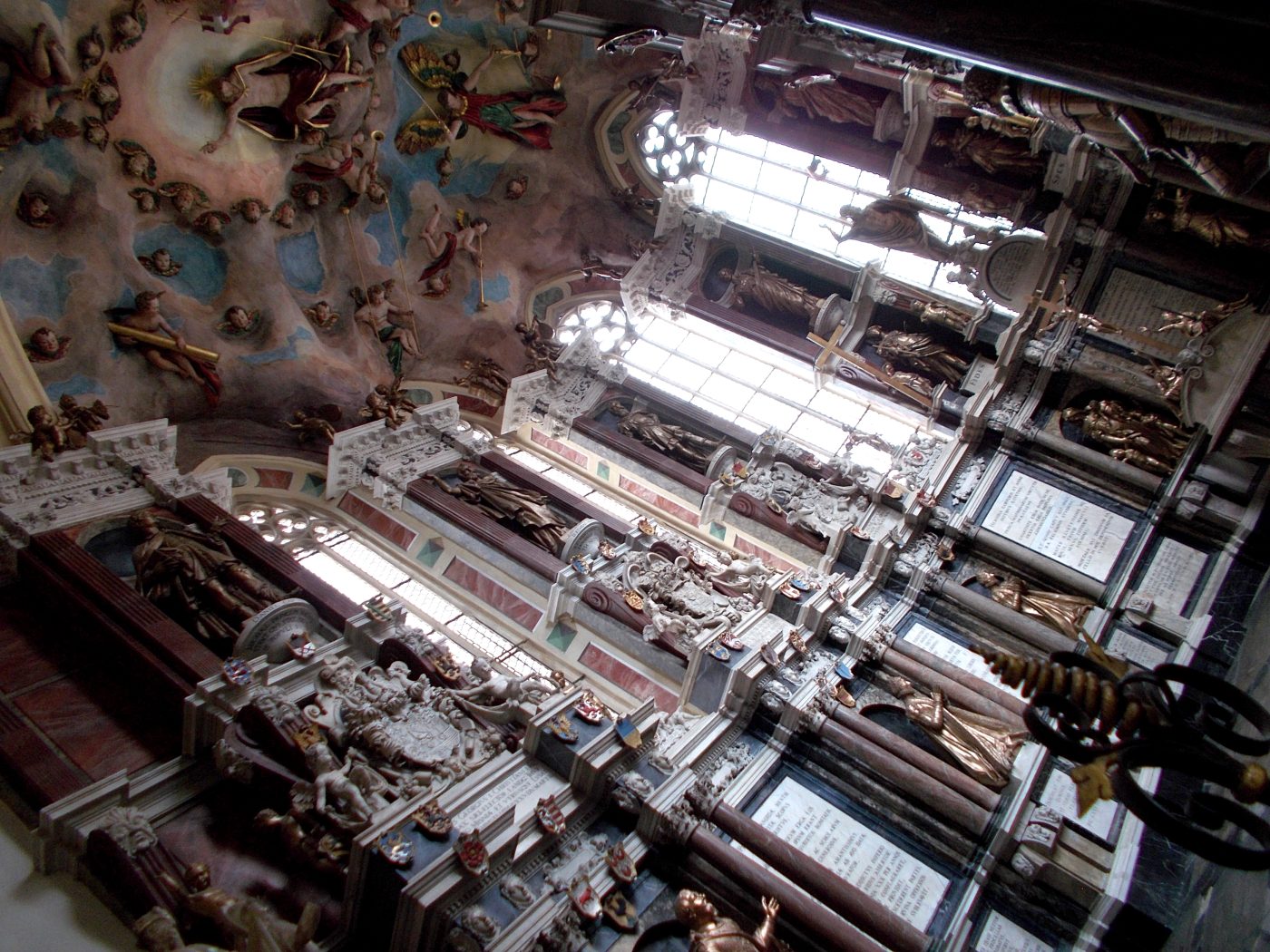
In der ausgestellten Rüstung starb Kurfürst Moritz nach
einer Schussverletzung. Eine Papierrolle zeigt das Einschussloch.